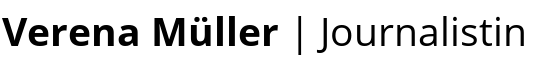Auf gutem Grund
Artenvielfalt gibt es nicht nur auf, sondern auch in der Erde. Weil sie dort schwindet, geht es den Äckern in Deutschland schlecht. Jetzt entdecken Forscher, wie man Böden heilen kann. Und eine Gemüsegärtnerin schwört auf Lasagne mit Pferdeäpfeln.
(Die WELT, Dez. 2020)

Manchmal kann Johanna Häger es selbst kaum glauben, wenn sie auf ihre Salate, ihren Stangensellerie, ihren Borretsch blickt. Wenn sie sieht, wie alles wächst, hier in Gerswalde, im Süden der Uckermark. Vor 13 Jahren kam sie hierher, und damals gab es nur wenig Grün. „Wie Kies“ sei der Boden damals gewesen, „da wuchs eigentlich nichts“. Selbst der Roggen, eine der besonders anspruchslosen Pflanzen, sei damals nur spärlich gekommen. Elf von hundert Punkten auf der Bodenskala, dem Maß für die Qualität eines Ackers, habe die Erde hier geholt. 30 Punkte braucht es, um Gemüse anzubauen. Ein Wert, der ihr damals unerreichbar erschien. Heute kaufen die Restaurants der Region bei Häger ein.
Der Boden Brandenburgs gilt weithin als schwierig. Weil er sandig ist. Und weil man sich hier, wie Häger erzählt, über Jahrzehnte hinweg „einen Dreck“ um den Humus, die organischen Bestandteile im Boden, gekümmert hat. Der Wind sei über die Flächen gefegt, kein Baum stand ihm im Weg. Dazu kam die Hanglage, die das letzte Bisschen Humus wegspülte. Trotzdem, das Land hatte es ihr angetan. Sie wollte damals raus aus Berlin, wollte zunächst einen Platz für ihre Pferde und bald ihren eigenen Gemüsebetrieb. Und sie merkte: Boden kann man heilen.
Für die meisten Menschen, selbst die umweltbewussten, ist Boden eine weitgehend abstrakte Größe. Auch, weil man ihm – anders als einem ausgedorrten Wald, verschmutzen Fluss oder gekippten See – von außen oft nicht anmerkt, ob er gesund ist, krümelig und voller Leben, oder verdichtet ist, vergiftet, zu wenig Sauerstoff und Stickstoff enthält. Dabei ist der Boden unsere Lebensgrundlage, in jeglicher Hinsicht. Wir stehen darauf, wir bauen darauf. 90 Prozent unserer Lebensmittel werden auf oder mit ihm erzeugt. Er beeinflusst das Klima, speichert Wasser und Nährstoffe. Ein Viertel aller Arten lebt dauerhaft in ihm, rund 90 Prozent aller Landlebewesen zumindest zeitweise, als Eier oder Larven.
Fehlen diese Organismen im Untergrund, geht es dem Boden schlecht. Geht es dem Boden schlecht, wird es kompliziert für das Leben auf der Erde.
Vielen Menschen ist das nicht klar, warnt nun der erste globale Bericht zur Bodendiversität, den die Welternährungsorganisation FAO vor einer Woche veröffentlicht hat. Dort heißt es, viele Menschen wüssten zwar mittlerweile um die wichtige Rolle, die die biologische Vielfalt über der Erde für die Ernährung spielt. Dass das Insektensterben zum Bestäubungsproblem der Landwirte und Obstbauern wird ist weithin bekannt. Aber die Arten in der Erde interessierten noch immer nur wenige. Intensive Landwirtschaft, Schadstoffe und Erosion setzten dem Boden beinahe unbeachtet zu. Allein in Deutschland geht durch Erosion etwa 10 Mal mehr fruchtbares Land verloren, als sich nachbilden kann.
Aber lässt sich der Verlust des Bodens überhaupt verhindern, kann man verarmten, erstickten Boden heilen? Oder sind Landwirte den Kräften der Erosion ausgeliefert und können nur versuchen, der Erde mithilfe von Dünger und Pestiziden Ernten abzuringen? Mancherorts wird nach einer Therapie für den Boden gesucht. Einige prüfen, ob es mit Kompostkompositionen klappt, andere versuchen sich an Pilz-Partnerschaften, windbrechenden Bäumen oder speziellen Pflanzensorten als Heilmittel. Und nicht alle sind sich einig über den richtigen Weg.
Johanna Häger hockt auf der Erde und bohrt ihren Finger in die fast schwarze, mit Holzstückchen durchsetzte Krume. Prompt tauchen ein Regenwürmer und Asseln aus dem Untergrund auf. Es riecht nach feuchter Erde. Acht Haufen reihen sich auf dem Hof hintereinander auf. Häger nennt sie fast zärtlich „Lasagnen aus Kacke und Stroh“. In zehn Zentimeter dicken Lagen schichtet sie hier alles auf, was an organischem Material auf dem Hof anfällt. Einen Meter breit, fünf Meter lang sind die Blöcke, unterschiedlich weit durchgezogen. So, wie bei einer guten Lasagne Hackfleisch, Bechamelsoße, Tomaten und Nudelplatten abwechselnd aufeinandergehäuft werden, stapelt Häger Pferdemist, anderen Mist, Laub oder Rasenschnitt. Schicht für Schicht. Chemisch betrachtet entsteht so ein ständiger Wechsel aus Stickstoff und Kohlenstoff, den beiden wichtigsten Elementen im Boden. Eine Bodenlasagne besteht aus bis zu zehn Schichten, getrennt durch Sägespäne und Tonerde, die Wasser und Nährstoffe binden. Abgedeckt wird der Stapel mit Stroh, das die Feuchtigkeit hält.
Zehn Jahre lang hat Häger ihre Bodenlasagne auf der kargen Fläche verteilt. Bereits nach einem Jahr wuchs das erste Gemüse. Bodenexperten aber wissen: Nährstoffe und Krümel alleine machen noch keinen gesunden Boden. „Man braucht eine hohe Vielfalt an Leben“, sagt Nico Eisenhauer. Er ist Bodenexperte und Professor am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig, als einer von mehr als 300 Autoren hat er den internationalen Bodenreport mit verfasst. Je vielfältiger die Gemeinschaft der Organismen unter der Erde, desto aktiver gehe es da unten zu und desto mehr wird dort belüftet, zersetzt, umgewandelt. Und je mehr passiert, umso ergiebiger sei in der Regel der Ertrag. Eisenhauers Fazit: „Was im Boden lebt, bestimmt, was oberhalb davon geschieht.“
Unter einem Quadratmeter gesunden Bodens leben meist mehrere Millionen Bodentiere, darunter Fadenwürmer, Regenwürmer, Milben, Asseln, Springschwänze und Insektenlarven. Hochgerechnet auf einen Hektar macht das etwa 15 Tonnen Lebendgewicht – soviel wie 20 Kühe. Dazu kommen mehrere Milliarden an Mikroorganismen an Bakterien, Pilzen, Algen und Einzeller – pro Gramm Erde.
Bis vor einigen Jahren gingen selbst Forscher davon aus, Vielfalt unter der Erde sei nicht so wichtig. Viele Arten machten prinzipiell den gleichen Job. Entscheidender sei es vielmehr, bestimmte Gruppen zu erhalten als einzelne Spezies.
Ein Irrtum.
Aktuelle Langzeitstudien haben mittlerweile gezeigt: Es kommt auf jede einzelne Art an. Sinkt die Vielfalt, fallen Rädchen im Getriebe weg, die Zahl und Qualität der biochemischen Prozesse geht insgesamt zurück. Es gebe ja einen Grund, so Eisenhauer, warum man in einem Ökosystem eine bestimmte Vielfalt findet, wenn man es nicht stört. „Da gibt es offenbar genügend Nischen und Aufgaben, die erfüllt werden müssen.“ Ein einzelner Fußballer könne schließlich auch kein Spiel gewinnen.
Die Vielfalt bringt einen weiteren Vorteil mit sich: Sie liefert eine Art Versicherung in unsicheren Zeiten. Mit dem Klimawandel verändern sich Temperaturen und Niederschlagsmengen. Da unklar ist, welche Arten unter den neuen Bedingungen gedeihen, ist es gut, wenn es möglichst viele gibt.
Eisenhauer sträubt sich zwar, das Leben in der Erde in wichtig und unwichtiger einzuteilen. Aber es gebe Organismen, die ganz besondere Aufgaben erledigen. „Regenwürmer sind die eigentlichen Ingenieure.“ Mit ihren Bauten und Gängen belüften sie den Boden; sie schaffen Nischen, in die sich andere Tiere zurückziehen und Wurzeln gedeihen können. Die Würmer fressen abgestorbene Pflanzen und Tiere, die sie verdaut als sogenannte Ton-Humus-Komplexe wieder auswerfen. Die halten wiederum das Wasser und die Nährstoffe im Boden.
Ein anderer wichtiger Player im Boden: Pilze. Viele von ihnen gehen intensive Verhältnisse mit Pflanzen und deren Wurzeln ein, im Fachjargon „Mykorrhiza“ genannt. Der Pilz wird von der Pflanze mit Kohlenhydraten versorgt – und stellt ihr im Gegenzug Wasser und Nährstoffe zur Verfügung. „Fast alles, was da draußen grün ist“, sagt Eisenhauer, „hängt irgendwie mit Pilzen zusammen.“
Pilze sind zentral, ist auch Arthur Schüssler überzeugt. Seiner Meinung nach sind sie sogar die Rettung. Man müsse, findet der Biologe, die Erde mit Pilzen gezielt impfen. Nur ein Boden, der von zarten Pilzhyphen durchdrungen ist, kann ein gesunder Boden sein. Allein mit Hilfe dieser hauchdünnen Fäden könnten Nährstoffe erschlossen werden, die für Pflanzenwurzeln oft unerreichbar sind. Gleichzeitig lockerten Pilze die Erde. Ein durchpilzter Boden, so ist Schüssler sicher, bräuchte weniger Dünger und Wasser. Seit sechs Jahren züchtet er mit seiner Firma in Darmstadt deshalb Bodenpilze im großen Stil. Er verspricht sich viel davon.
Christel Baum, Boden- und Mykorrhizakundlerin an der Universität Rostock, ist allerdings skeptisch. Auch sie weiß um die Bedeutung der Pilz-Wurzel-Beziehungen für die Böden. Sie sagt aber auch: „An jedem Ort hat sich im Laufe der Evolution ein Boden-Mikrobiom entwickelt, das sich an die speziellen Bedingungen angepasst hat.“
Bringe man aber fremde Pilze und Bakterien von außen ein, passiere im günstigsten Fall gar nichts. Im schlimmsten Fall aber könnten die neuen die alteingesessenen Pilze verdrängen. Kurzum, man solle das Geld für die Mykorrhiza-Kur lieber sparen. Nur auf „krass gestörten“ Flächen wie alten Tagebauen könnten sie helfen, den Boden wiederzubeleben.
Um den Boden zu verbessern solle man eher Pflanzensorten pflanzen, die mehr Seilschaften mit Pilzen eingehen. Und man sollte die Arten stärken, die man vor Ort bereits findet. Ansonsten sei für die Heilung eines Bodens tatsächlich weniger mehr: weniger Düngen, weniger Pflügen, den Boden nicht unbepflanzt lassen.
Auch Thomas Domin versucht, mit möglichst wenig viel zu erreichen. Sein Hof liegt in der Oberlausitz, einer der Regionen in Deutschland, die am stärksten von Erosion betroffen sind. Rund 180 Tonnen Boden pro Hektar fegen Wind und Wasser hier Jahr für Jahr hinweg. Reiche Ernten müssen dem erodierten Boden abgerungen werden. Domin versuchte es zunächst mit weniger Pflügen, Zwischenfrüchten und anderen Methoden, um die oberste Bodenschicht zu schonen. Verloren ging sie trotzdem. Nach wie vor stiegen Staubwolken über seinen Feldern auf, blies der Wind den kostbaren Boden davon.
Domins Lösung: Er pflanzte Bäume in seine Felder. Zehn Streifen mit mehr als 30.000 Stück sind es mittlerweile. Zunächst setzte er auf schnellwachsende Sorten, um dem Wind zügig etwas entgegenzusetzen: Pappeln und Weiden. Heute pflanzt er auch Bäume, die Früchte tragen und Holz liefern: Esskastanien, Erlen, Eichen. Auf dem Acker dazwischen wachsen die Klassiker: Roggen, Hafer, Mais.
Agroforstsystem nennt sich diese Kombination aus Ackerfrüchten und Gehölzen. Besonders in den Tropen eine gängige Methode, lässt sich so doch gleichzeitig Landwirtschaft betreiben und Regenwald schützen. Auch in Deutschland reihen sich seit jeher vielerorts Bäume um den Acker, um den Wind abzubremsen. „Die stehen aber oft einige hundert Meter voneinander entfernt“, sagt Christian Böhm, Forstwissenschaftler an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Die Feldränder seien dann zwar geschützt. Über die große Fläche nehme der Wind aber wieder an Fahrt auf.
Böhm hat untersucht, wie ein ideales System aussehen müsste. Eines, das den Luftzug bändigt, die Felder aber nicht zu kleinteilig und damit unwirtschaftlich macht. Er experimentierte in Brandenburg mit verschieden Abständen zwischen den Baumreihen und stellte fest: 50 bis 70 Meter sind perfekt. Dann verdunsten 20 Prozent weniger Wasser und der Wind wird um 70 Prozent abgebremst, da er gar nicht erst bis auf den Boden gelangt. Das Entscheidende aber ist, dass die besonders starken Böen, die, die den größten Schaden anrichten, gebrochen werden. „Erosion verläuft ja vor allem in Einzelereignissen“, erklärt Böhm. In Mecklenburg-Vorpommern werden etwa 100 Tonnen pro Hektar jedes Jahr durch Extremwinde abgetragen. Nutze man die Methode überall, sagt Böhm, wäre die Erosion fast komplett ausgelöscht.
Am Anfang, erzählt Bauer Domin rückblickend, galt er als „der Spinner mit den Bäumen“. Natürlich, die waren zunächst eine enorme Investition, anders als bei seinem Acker bekommt er dafür keine Unterstützung von der EU. Zudem: An den Feldrändern konkurrieren sie mit dem Getreide um Licht und Wasser, da wächst weniger als vorher. „Dafür gibt’s in der Mitte deutlich mehr.“ Im Schnitt erntet Domin jetzt insgesamt fast 20 Prozent mehr als auf den leergeräumten Flächen. Auch finanziell gleicht das die Baumkosten langfristig wieder aus. „Jetzt sehen auch die anderen Landwirte immer mehr, dass man was tun muss.“ Jedes Jahr würden die weniger ernten, wenn sie nicht mit allerlei Chemie und Technik nachhelfen. Für Domin ist das Agroaufforsten heute „das System der Zukunft“.
Zurück in der Uckermark. „Der Boden funktioniert wie ein Konto“, sagt die Gemüseanbauerin Johanna Häger. Man könne was abheben, wenn man ihn nutzt, müsse dann aber wieder was einzahlen, sprich: sich um die Nährstoffe und Struktur kümmern. Sie ist mit ihrem Land heute in den grünen Zahlen, ober- und unterhalb der Fläche. Insekten, Vögel, Eidechsen, Schlangen sind zurückgekehrt, der Igel wohnt unterm Holzhaufen. Wie hoch ihre Bodenpunktzahl inzwischen ist, kann sie nicht genau sagen. „40 mindestens“, schätzt sie. Eine Handvoll Erde bröselt durch ihre Finger. „Das macht mich glücklich.“