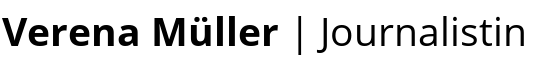Fahnder für den Artenschutz
Ob als Haustier, Modeprodukt oder Möbelstück – das Geschäft mit seltenen Tier- und Pflanzenarten boomt und ist zu einem der lukrativsten illegalen Wirtschaftszweige geworden. Um den Ausverkauf der Natur zu stoppen, werden Forscher zu Ermittlern im Auftrag der Natur. Indizien liefern ihnen dabei: DNA, Artenkenntnis und Kot.
(NATUR, Oktober 2016)

Friedlich wirkt es hier an diesem Oktobertag, morgens um sieben in der Einfamilienhaussiedlung am Rande einer deutschen Kleinstadt. Eine Amsel singt, eine Taube gurrt, die Nacht ist in ihren letzten Zügen.
Doch der Schein trügt. In einem der Vorgärten haben sich Einsatzkräfte in kugelsicherer Weste in Position gebracht. Im Visier: Das Haus von Jochen Schlüter*, das sich hinter meterhohen Hecken vor neugierigen Blicken von außen versteckt. Denn zu verbergen hat er jede Menge. Bereits seit Längerem haben die Behörden seine fragwürdigen Machenschaften auf Reptilienbörsen und Internetplattformen im Visier. Doch bisher hatten sie nichts gegen ihn in der Hand. Das soll sich heute ändern.
Ein Beamter klingelt an der Haustür. Auch ein zweites und drittes Mal. Dann der Befehl, sie aufzubrechen. Plötzlich geht alles ganz schnell und die Beamten von Zoll, Naturschutzbehörde und Forschungseinrichtungen stehen im schummerigen Licht von Schlüters Wohnzimmer. Um sie herum zweihundert Terrarien mit Exoten aller Couleur. Schlangen, Schildkröten, Geckos, Warane und andere Echsen. Was sie hier wollen würden, schleudert ihnen der Hausherr in Feinrippunterhemd und Jogginghose aufgebracht entgegen und lässt noch schnell etwas in seiner Hosentasche verschwinden. Ein erstes Verdachtsmoment.
Als sich die Experten umschauen, fällt ihnen vor allem ein Borneo-Taubwaran auf, aktuell besonders heiße Ware in Sammlerkreisen. Bis zu 10 000 Euro erzielt etwa ein Paar dieser Echsenart, die lediglich auf der Insel Borneo vorkommt. Widerwillig zeigt Schlüter ihnen auf Anweisung auch den Inhalt seiner Tasche. Nur ein Timor-Waran, winkt er lapidar ab. Die zweite Ungereimtheit. Denn was die Experten da vor sich sehen, ist eindeutig ein Mitchell-Waran, der nur im äußersten Norden Australiens in freier Wildbahn zu finden ist, und bisher noch kaum im Handel ist. Entsprechend hohe Preise könnte er erzielen. „Wenn du Tiere davon siehst und sie bekommen kannst, solltest du zugreifen“, heißt es in einer der Online-Börsen.
Es handele sich nicht um Tiere aus freier Wildbahn, sondern lediglich um Nachzuchten, gibt der Hausherr trocken zu verstehen. Doch die Experten sind skeptisch: Eine Zucht eines dieser hochspezialisierten Tiere ist kaum oder nur unter extrem aufwendigen Bedingungen möglich. Beinahe zwangsläufig müssen sie demnach direkt aus ihren natürlichen Lebensräumen geraubt worden sein. Aussage gegen Aussage.
Einige Wochen später und einige hundert Kilometer weiter östlich. Nachdenklich steht Mark Auliya in seinem Leipziger Büro im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung vor einer Landkarte Südostasiens. In der Hand die Bilder zahlreicher Handtaschen, blau und rot glänzen ihre Schuppen. „Gerade frisch vom Zollamt am Leipziger Flughafen beschlagnahmt“, gibt der Biologe zu verstehen. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit den Regelungen und Machenschaften des internationalen Reptilienhandels. Häufig wird er vom Zoll in Sachen Reptilienhandel um Rat gefragt.
„Hier haben wir wieder ein Malayopython reticulatus, einen Netzpython“, mutmaßt er mit Blick auf das Schuppenmuster der Taschen. Laut Dokument stammen sie aus Vietnam. Er vermutet jedoch, dass es sich um die Häute von Artgenossen aus Malaysia handelt, die falsch deklariert wurden, um ungehindert in die EU gelangen zu können.
Der Grund: Die malaysischen Behörden hatten sich wesentlich höhere Exportquoten innerhalb des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES ausbedungen als ihr Nachbarland. Vermutlich wurden daher zehntausende Schlangenhäute aus Nachbarländern über die Grenzen geschmuggelt und mit malaysischer Herkunft versehen – um dann von dort „legal“ nach Europa zu gelangen, zum Beispiel aus Indonesien. „Von Netzpythons wurden bis vor einigen Jahren wesentlich mehr Häute aus Malaysia nach Mitteleuropa exportiert als aus dem sechsmal größeren Nachbarn Indonesien, wo gleichzeitig auch vielmehr Tiere dieser Art vorkommen“, sagt Auliya. Die EU reagierte zwar darauf und verbot Importe von Netzpython-Häuten aus Malaysia. Parallel schnellten jedoch die Exportzahlen Vietnams auf wundersame Weise in die Höhe. Das legt die Vermutung nahe, dass nun viele Häute von Netztpythons von Malaysia nach Vietnam geschmuggelt werden.
Dass es keineswegs lapidar ist, aus welcher Region ein Exot stammt, lässt sich am Python besonders gut beobachten. Wo er fehlt, treten teilweise bereits Rattenplagen auf. Denn die Riesenschlangen stehen am Ende der Nahrungskette. Fallen sie als Jäger weg, gerät das gesamte ökologische Gleichgewicht durcheinander. Gleichzeitig steigt die Gefahr, dass sich Krankheitserreger ausbreiten. „Es ist absurd, wie oft ich in Südostasien mit Schlangenjägern unterwegs war und wir rund um die Reisfelder Plastiktütchen fanden, die Rattengift enthielten“, so Auliya.
Ein Barcode für die Schlange
Ob Auliya auch diesmal den richtigen Riecher hat und statt einem vietnamesischen ein malaysischer Python für die Tasche herhalten musste, ist äußerlich kaum erkennbar – selbst wenn sie noch nicht zum Modeaccessoire verarbeitet worden wären. Denn äußerlich sind die Populationen dieser Riesenschlange kaum voneinander unterscheidbar. In ihrem tiefsten Inneren jedoch schon: Die DNA der Tiere unterscheidet sich je nach geografischer Herkunft – und könnte so das entscheidende Indiz für einen Tierschmuggel liefern.
So zumindest die Vision Auliyas und seiner Kollegen der Royal Zoological Society of Scotland. Seit drei Jahren arbeiten sie an einem Barcode für die Schlange, einer Methode, die mithilfe ihres genetischen Fingerabdrucks die Herkunft der Riesenschlangen offenlegt. Zeig‘ mir deine DNA und ich weiß, woher du kommst. Aktuell haben die Wissenschaftler dabei die beiden größten Riesenschlangen Asiens im Fokus, die gleichzeitig die größte Ressource der Schlangenlederindustrie sind: neben dem Netzpython, auch den Tigerpython. Um die Herkunft zu bestimmen, extrahieren die Forscher aus Gewebeproben die DNA und konzentrieren sich dabei auf einen Abschnitt im Erbgut der Mitochondrien, die als „Kraftwerke der Zelle“ für die Energiegewinnung zuständig sind. Ein bestimmter Abschnitt dieser DNA unterscheidet sich zwischen den einzelnen Populationen, sodass sich daran bereits Pythons von den Philippinen beispielsweise von ihren Verwandten des indonesischen Borneos abgrenzen lassen. Haben sie dann den genetischen Fingerabdruck der einzelnen Populationen, könnten Institutionen wie der Zoll in einigen Jahren per DNA-Schnelltest und einer entsprechenden Datenbank erfahren, ob das Tier, das für eine Ledertasche sterben musste, tatsächlich aus Vietnam stammt oder doch vom der indonesischen Insel Sulawesi.
Sulawesi, paradiesisches indonesisches Eiland nördlich von Bali. Irgendwo in den Tiefen seines tropischen Regenwaldes. Immer wieder reiste Auliya hierhin und die anderen Regionen Südostasiens, auf der Suche nach einem: Möglichst vielen Gewebeproben der einzelnen Python-Populationen, um Futter für seine Gendatenbank zu sammeln.
Erinnert er sich an die Forschungsreise zurück, weiß er, dass er dort nicht immer als willkommener Gast empfangen wurde. Häufig war er der Nestbeschmutzer. Gerade wenn er eine der unzähligen Schlangenfarmen aufsuchte, auf denen die Tiere bei lebendigem Leibe gehäutet werden, um die Häute möglichst lange frisch und flexibel zu halten. Einmal, da wurde es auch brenzlig, als ihm auf Schritt und Tritt eine Truppe Männer auf dem Tiermarkt in Bangkok folgte, nachdem er tagelange Nachforschungen über den Reptilienhandel in Thailand hinter sich hatte. „Da wusste ich wirklich nicht, ob ich den Markt tatsächlich einfach verlassen könnte, ohne an der nächsten Häuserecke weggefangen zu werden.“
Eines Tages, so hofft er, wird er nicht nur Schlangen aus verschiedenen Regionen voneinander unterscheiden zu können, sondern auch Wildfänge von Zuchttieren. Dazu will er sich des glücklichen Umstands bedienen, dass es von Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff jeweils verschieden schwere Varianten in der Natur gibt. Im Kot von Tieren finden sich diese Kohlenstoff- und Stickstoff-Isotope je nach Nahrung in unterschiedlichen Verhältnissen und zeigen an, von welcher Nahrung sich ihre Beutetiere ernährt haben. Hat eine Schlange zum Beispiel mit Pellets gefütterte Mäuse verspeist, stammt sie höchstwahrscheinlich aus einer Zuchtstation. Bestand das Menü aus Nagetierarten, die sich von Reispflanzen ernährt haben, war das Tier wohl in freier Wildbahn zuhause.
Das sich das Mengenverhältnis verschiedener Isotope eines chemischen Elements in der Natur je nach Region unterscheidet, und damit der Fingerabdruck einer Landschaft ist, machen sich auch andere Naturermittler auf ihrer Mission zu nutze. So auch Stefan Ziegler und seine Kollegen vom WWF. Sie sind dem weißen Gold auf der Spur: Elfenbein. Einem der lukrativsten Naturprodukte überhaupt. Mit bis zu 300 Euro lockt ein Kilogramm, mit bis zu 18 000 Euro demnach ein 60 Kilogramm schwerer Stoßzahn eines ausgewachsenen Elefantenbullen. Besonders in den Herkunftsländern schwindelerregend hohe Summen, die den illegalen Handel trotz strikter Regularien boomen lassen.
Eine Übersicht des International Fund for Animal Welfare (IWAF) über die größten Coups des vergangenen Jahres im Hauptabsatzmarkt Ostasien lässt die Dimensionen nur erahnen: Im April zogen Strafverfolger in Thailand bei nur zwei Einsätzen über sieben Tonnen des weißen Goldes aus dem Verkehr. In Singapur beschlagnahmten die Behörden einen Monat später bei einer Razzia 3,7 Tonnen Elfenbein. Knapp vier Tonnen brachte auch das Handelsgut bei drei Einsätzen in Vietnam auf die Waage. Nach Ansicht von Interpol sind solche großen Beschlagnahmungen ein sicherer Hinweis darauf, dass das organisierte Verbrechen hinter dem illegalen Handel steckt.
Wie legales Elfenbein von illegalem unterscheiden
„Natürlich wissen diese Banden genau, wo hier die Schlupflöcher liegen“, so Artenschutzexperte Ziegler. Denn nachdem sich die Zahl der Elefanten in einigen afrikanischen Ländern durch das strikte Handelsverbot von 1989 erholt hatte, plädierten insbesondere Simbabwe, Südafrika, Namibia und Botswana dafür, einen kontrollierten Handel mit Elfenbein zuzulassen. Dringend benötigte Einnahmen für den Naturschutz könnten so generiert werden, so das Hauptargument für den Handel. Den vier Ländern im südlichen Afrika wurde seitdem zweimal gewährt, über 150 Tonnen gelagertes Elfenbein zu versteigern und nach China und Japan zu exportieren. Das Problem dabei: Der freie Handel erschwert die Unterscheidung zwischen legalem und illegalem Elfenbein. Denn Stoßzähne des asiatischen Elefanten oder aus Ländern wie Kamerun oder Togo sind weiterhin illegale Ware und werden häufig einfach mit einer anderen Herkunft versehen. Das legale Geschäft wird somit vielerorts zum Deckmantel für Schmuggel und Wilderei.
Um unter diesen Mantel zu schauen, erweisen sich auch hier die häufigsten chemischen Elemente als wesentliche Beweismittel. Je nachdem, in welcher Klimazone ein grauer Dickhäuter mit welchem Trinkwasser und welchem Boden lebte und welche Pflanzen er vorrangig gefressen hat, lagert er charakteristische Varianten der Elemente Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel in sein Gewebe ein. So auch in seine Stoßzähne. „In ihnen spiegelt sich geradezu die Isotopenlandschaft wider, in der er gelebt hat, bevor er gestorben ist“, erklärt Ziegler. Bis auf 300 Kilometer genau können sie so einem Zahn seinen ursprünglichen Lebensraum zuordnen. Den ersten Erfolg feierten die Artenschützer im Frühjahr 2011. Damals war vom Zoll in Leipzig eine in Nigeria aufgegebene Sendung von 35 Kilogramm Elfenbein beschlagnahmt worden. Die Isotopenanalyse brachte jedoch ans Tageslicht, dass das Elfenbein mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Zentralafrika stammen muss.
„Diese Methode wird kaum die Wilderei beseitigen können“, räumt Ziegler ein. Dennoch biete sie immerhin die Chance, das Strafmaß im Falle von illegal gehandeltem Elfenbein höher ausfallen zu lassen. „Außerdem können wir dadurch aktuelle Wilderei-Schwerpunkte ausmachen und dort besonders aufmerksam sein.“
Im Ernstfall sieht Fleisch aus wie Fleisch
Doch selbst wenn das gelingen sollte, droht den Dickhäutern noch von anderer Seite Gefahr. Häufig sind Wilderer gar nicht vorrangig hinter ihren Stoßzähne her, sondern hinter einer scheinbar profaneren Sache: ihrem Fleisch. Das bringt für die Wilderer selbst sogar häufig mehr Geld ein als Elfenbein. Das weiße Gold wird in den internationalen Markt geschmuggelt, das Fleisch kann hingegen auf den regionalen Märkten verkauft werden. Dort gilt es häufig als echte Delikatesse.
Das Problem ist jedoch auch hier: Den Jägern kann oft nichts nachgewiesen werden. Denn im Ernstfall sieht Fleisch wie Fleisch aus – egal, ob es von einem Elefanten oder einem Schwein stammt. Entfernen die Jäger Knochen und Fell und bringen nur das „rote Fleisch“ in Umlauf, hat jeder Staatsanwalt Schwierigkeiten, gerichtsfeste Beweise zu erbringen. Und ohne die ist keine rechtskräftige Verurteilung möglich.
Wie lässt sich also zweifelsfrei entscheiden ob das Stück von einer Spezies stammt, die national und international geschützt ist? Auch hier kann die DNA Auskunft geben.
Im vergangenen Jahr eröffnete eigens dafür ein modernes Labor in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, das erste seiner Art in Ostafrika. Unter der Leitung der staatlichen kenianischen Wildschutzbehörde soll es helfen, generell den zunehmend florierenden Handel mit Buschfleisch einzudämmen. Denn neben Elefanten landen auch Giraffen, Affen, Zebras, Büffel und Antilopen immer häufiger auf Marktständen und in Metzgereien afrikanischer Städte. Selbst Interpol hat angekündigt, dabei eng mit dem Labor zusammenarbeiten – auch wenn hier andere Gründe als der Artenschutz im Blickfeld stehen. „Der illegale Handel mit Buschfleisch führt dazu, dass sich gefährliche Krankheiten ausbreiten, die von Tieren auf den Menschen übertragbar sind“, heißt es in der Begründung.
Doch nicht nur Tiere sind heiße Ware auf dem Schwarzmarkt der Naturraritäten. Ebenfalls begehrt: Bäume. Das Geschäft mit illegalem Holz hat mittlerweile einen jährlichen Umsatz von fast zehn Milliarden Euro erreicht. Es gilt als sicherer und lukrativer als das mit Tieren. Allen voran Ebenhölzer und andere wertvolle Tropenhölzer wie Mahagoni, Sapeli oder Khaya.
Illegaler Holzhandel: Hier ein Pizzaheber, da ein Spielzeug
Obwohl der Handel mit ihnen laut Washingtoner Artenschutzabkommen verboten ist, verspricht er einfach zu große Gewinne, als das er nicht trotzdem stattfinden würde. Ein Kubikmeter Mahagoni erzielt über tausend Euro, der einer Fichte nur zwischen 50 und 80 Euro. Bernd Degen, Direktor des Thünen-Instituts für Forstgenetik, kennt die Ausmaße des illegalen Holzhandels. In seinem Labor stapeln unzählige Holzprodukte von der Terrassenplatte bis zum Kinderspielzeug – eingesendet vor allem von Holzhändlern, die sich in Bezug auf ihre Zulieferer absichern möchten, Umweltverbänden und von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, der Kontrollbehörde in Deutschland, wenn es um die Einhaltung der EU-Holzhandelsverordnung in Deutschland geht.
Seit 2013 gilt die EU-Holzhandelsverordnung, die hier den Handel mit Hölzern aus illegalem Einschlag verbietet. „Hier haben wir zum Beispiel einen Pizzaheber“, erklärt Degen mit Blick auf das Küchenutensil vor sich. „Offiziell wurde es als chinesisches Sapeli ausgegeben, tatsächlich stammt es aber aus Zentralafrika.“ Nicht umsonst würden innerhalb eines Landes Einschlagskonzessionen vergeben werden. Umgehe man diese jedoch und entnehme aus einem Ökosystem zu viele Bäume, sei seine Regenerationsfähigkeit in Gefahr und die Baumart könne in einer Region bald ganz verschwinden.
Einer der Umschlagsplätze für das illegale Holzgeschäft liegt nur knapp 30 Kilometer von Degens Büro entfernt: der Hamburger Hafen. Um den Betrügern hinter den Holzladungen auf die Schliche zu kommen, muss Bernd Degen jedoch nicht nur 30 Kilometer reisen, sondern weite Strecken auf sich nehmen – zu jenen Orten in den Tropen, an denen das Verbrechen seinen Anfang nimmt. Nach Jaunde etwa, der Hauptstadt Kameruns. Eines seiner Hauptbeweismittel auch hier: das Erbgut der Bäume.
Zwei Autostunden von Jaunde entfernt dringt Bernd Degen in den schwülheißen Regenwald vor. Oder in das, was von ihm noch übrig geblieben ist, um Holzproben zu sammeln. Referenzmaterial für seine Holz-Gendatenbank, durch die die Herkunft von Pizzaheber und Co. bestimmt werden kann. Hier und da bleibt er stehen, um mit routinierten Handgriffen kronkorkengroße Stücke aus den Baumstämmen der jahrhundealten Giganten zu bohren.
Um die in den Tropen Afrikas wirtschaftlich wertvollen Arten zu erfassen, nehmen die Forscher um Bernd Degen zusammen mit Einheimischen in dem Verbreitungsgebiet einer Baumart an 50 bis 100 Orten insgesamt bis zu 2000 Proben aus dem Kambium der Bäume, der dünnen Schicht aus lebenden Zellen zwischen Rinde und Holz. Sie sammeln so viele kleine Puzzleteile, die sich nach der DNA-Analyse in seinem Hamburger Labor nach und nach zu einer großen Holzdatenbank zusammensetzen. Wenn die einmal vollständig ist, kann Degen bis auf hundert Kilometer genau sagen, woher ein Stück Holz stammt. Ein illegaler Khaya-Baum aus dem Kongo könnte dann nicht mehr als legaler Khaya-Baum aus Kamerun exportiert werden.
Dabei macht sich der Forscher zunutze, dass sich nicht nur Bäume unterschiedlicher Art genetisch voneinander unterscheiden, sondern auch solche derselben. In Naturwäldern sind dabei die genetischen Unterschiede umso größer, je weiter sie voneinander entfernt stehen. Samen und Pollen verteilen sich je nach Baumart in einem Radius von einigen Hundert Metern bis zu mehreren Kilometern; so bilden die Bäume Familienstrukturen, die sich genetisch nachverfolgen lassen – ähnlich einem Vaterschaftstest beim Menschen. „Schwierig wird es natürlich, wenn Bäume aus Grenzgebieten zwischen zwei Ländern kommen“, räumt Degen ein. „Denn woher sollen die Gene wissen, wo die Landesgrenze liegt?“
Ob Waran, Elfenbein oder Mahagoni – auf jährlich etwa 19 Milliarden Dollar, rund 14,7 Milliarden Euro, schätzte der WWF in einem Bericht von 2013 die jährlichen Einnahmen aus dem illegalen Handel mit geschützten Naturgütern. Damit ist das illegale Geschäft mit seltenen Pflanzen- und Tierarten nach Drogenhandel, Produktpiraterie und Menschenhandel das viertgrößte illegale Geschäftsfeld weltweit. Und das, so heißt es in dem Report, sogar mit steigender Attraktivität. Denn verglichen mit anderen Verbrechen sei der Ertrag hoch und das Risiko, erwischt zu werden, noch immer gering.
Auch Reptiliensammler Schlüter wird vermutlich wieder glimpflich davonkommen. Ihm eindeutig nachzuweisen, dass es sich bei den Waranen um Tiere aus freier Wildbahn handelt, könnte trotz der Indizien schwer werden. Im Zweifel für den Angeklagten. Den Behörden könnten, wenn sie Glück haben, noch winzige Wesen zu Hilfe eilen: Parasiten am Körper der Tiere. Mit deren Hilfe ließe sich eindeutig auf Wildtiere schließen. War der Hausherr jedoch besonders gewieft, hat er versucht, auch diese Spur zu vertuschen und sie sorgfältig von der Haut entfernt.
Eine seltene Art wird entdeckt? „Zwei Deutsche kaufen ein Flugticket“
Im Falle der Borneo-Taubwarane könnte er insgesamt fein raus sein. Eigentlich dürfte das Reptil zwar gar nicht auf den deutschen Markt kommen, denn Fang und Export sind in seinem Heimatland verboten. Sind sie jedoch einmal außerhalb ihres Herkunftslandes, dürfen sie in Europa frei verkauft werden.
„Ein Spruch unter uns Artenschützern lautet: Wird eine seltene Art entdeckt. Was ist das erste, was passiert?“, fragt Sandra Altherr von der Naturschutzorganisation Pro Wildlife sarkastisch. „Zwei Deutsche kaufen ein Flugticket.“ Wenn es darum gehe, seltene Arten aus ihren Lebensräumen in die heimischen vier Wände zu bringen, würden die Deutschen tatsächlich eine traurige Vorreiterrolle einnehmen. Diese Erfahrung hätten beispielsweise die neuseeländischen Artenschutzbehörden gemacht: Binnen drei Jahren gingen ihnen fünf Deutsche ins Netz, die seltene Geckos außer Landes schmuggeln wollten. „Da scheint es hierzulande wirklich ein besonderes Faible zu geben. Je seltener, desto begehrter und teurer. Das treibt die Art umso schneller an den Rand des Aussterbens. Ein echter Teufelskreis.“
Altherr fordert deshalb einen anderen Weg: Eine Gesetzgebung nach Vorbild des sogenannten Lacey-Acts, der in den USA schon seit mehr als hundert Jahren gilt. Dieser untersagt es grundsätzlich, mit Tieren zu handeln, deren Fang und Export in ihrem Herkunftsland verboten ist. „Ein vergleichbares Regelwerk in der EU wäre ein großer Wurf“, sagt Altherr. „Denn hier stürzen sich die Exotensammler gerade auf diese Lacey-Arten. Die sind heiß begehrt, weil selten. Und trotzdem haben die Sammler bisher keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten.“
Der Taubwaran könnte noch eine andere Chance erhalten, um dem vollständigen Ausverkauf zu entkommen: Im September dieses Jahres soll auf der nächsten Vollversammlung des Washingtoner Artenschutzabkommens in Südafrika darüber entschieden werden, ob er auf der Leiter der Schutzbedürftigkeit ganz nach oben auf Anhang I des Abkommens klettert. Dann dürften keine Tiere aus freier Wildbahn mehr gehandelt werden. „Natürlich ist auch das kein Allheilmittel“, räumt Altherr ein. Denn alles werde gehandelt, sei es auch noch so streng geschützt. Den Händlern würden nur deutlich mehr Steine in den Weg gelegt werden und ein Großteil der potentiellen Käufer würde die Finger von den heißen Sachen lassen. Vor allem jedoch würden die Verbrechen an der Natur nicht mehr nur als reines Kavaliersdelikt angesehen werden.