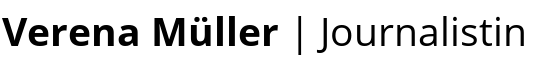Abgehängter Osten
In Ostdeutschland dienen die Erfahrungen in der Nachwendezeit häufig als Erklärung und Projektionsfläche für individuellen Frust und Wahlergebnisse. Vor den Landtagswahlen fragt man sich: Wie geht es dem Osten wirklich?
von Verena Müller, Philipp Neumann und Theresa Martus
(u.a. Hamburger Abendblatt, August 2019)

30 Jahre nachdem der Mauerfall den Anfang vom Ende der DDR markierte, ist „der Osten“ wieder da: Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag und Thüringen im Oktober sind die ostdeutschen Bundesländer und ihre Bewohner Thema in Medien, Politik und Wissenschaft.
Neben den Erfolgen der Wiedervereinigung wird – mit dem Abstand einer Generation – auch über Enttäuschungen und Frust gesprochen. Die Erfahrungen in der DDR und der Nachwendezeit, die die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und halb Berlin verbinden, dienen häufig als Erklärung und Projektionsfläche – für individuellen Frust genauso wie für Wahlergebnisse. Grund genug für eine Bestandsaufnahme. Wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch – wie geht es Ostdeutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall?
Wirtschaft
„Blühende Landschaften“ versprach Helmut Kohl den Ostdeutschen 1990 und meinte dabei weniger Blumen und mehr den wirtschaftlichen Aufschwung, den viele in den damals neuen Ländern erhofften. Doch die Blütezeit ließ erst einmal auf sich warten.
Stattdessen kam die Treuhandanstalt, die die ostdeutsche Wirtschaft fit machen sollte für den Kapitalismus und deren Wirken sich bei vielen als Trauma ins Gedächtnis gegraben hat. Es gab Umstrukturierungen, Privatisierungen und viele Entlassungen. Jeder Fünfte war zeitweise ohne Arbeit.
Von diesen Zahlen ist der Osten mittlerweile weit entfernt: Im August 2019 sind rund 540.000 Menschen in Ostdeutschland arbeitslos, das entspricht einer Quote von 6,4 Prozent. Im Westen ist dieser Anteil mit 4,8 Prozent etwas niedriger.
Doch auch wenn die allermeisten Arbeit haben: Wie viel Geld Angestellte dafür bekommen, unterscheidet sich zwischen Ost und West noch immer deutlich. Die 60 Landkreise und Städte mit den bundesweit niedrigsten Verdiensten liegen allesamt auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA). Am niedrigsten ist der Brutto-Monatsverdienst im ostsächsischen Görlitz mit durchschnittlich 2272 Euro. Am anderen Ende der Skala steht dagegen das bayerische Ingolstadt mit monatlich 4897 Euro brutto im Mittel. Die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen sind dabei im Osten geringer.
Ein Teil dieser Differenz wird aufgefangen durch Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten, vor allem die Mieten sind in vielen ostdeutschen Städten immer noch günstig. Insgesamt aber haben die Menschen in Ostdeutschland immer noch weniger Geld als ihre Mitbürger auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik: Das Nettovermögen privater Haushalte lag im Westen 2018 bei 182.000 Euro – und damit um fast 100.000 Euro höher als im Osten.
Ein Grund für die Diskrepanz: Während einige große Unternehmen zwar in ostdeutschen Ländern produzieren, sitzen die Konzernzentralen – mit den besser bezahlten Führungspositionen – fast immer in Westdeutschland. Von den 30 DAX-Unternehmen hat nicht eines seinen Hauptsitz im Osten.
Gesellschaft
An vielen Stellen wirkt das kulturelle und gesellschaftliche Erbe der DDR noch erkennbar nach. Bei der Jugendweihe zum Beispiel, die in Ostdeutschland immer noch für viele Jungen und Mädchen den Übergang ins Erwachsenenalter markiert.
Die Beliebtheit dieses Brauchs liegt auch daran, dass viele mit den religiösen Alternativen – Konfirmation und Firmung – wenig anfangen können. Während in den westdeutschen Flächenländern jeweils mindestens eine, oft aber mehrere Millionen Menschen einer der beiden großen christlichen Kirchen angehören, sind es in den ostdeutschen Ländern im besten Fall wenige Hunderttausend. Insgesamt gehören in Ostdeutschland nur rund 20 Prozent der Menschen einer der großen christlichen Religionsgemeinschaften an. In Sachsen ist es ein Viertel, in Thüringen sogar fast ein Drittel. Im Westen ist es, vereinfacht gesagt, genau umgekehrt.
Während hier Kontinuität herrscht, hat der Fall der Mauer an anderen Stellen große Umbrüche nach sich gezogen. 3,7 Millionen Menschen haben nach einer Auswertung von „Zeit online“ zwischen 1990 und 2017 den Osten verlassen. Ein Verlust, der nicht aufgewogen wurde durch die 2,5 Millionen Zuzüge aus dem Westen. Vor allem die Jungen und gut Ausgebildeten waren es, die gingen und nur noch zu Besuch wiederkamen. In vielen Orten, vor allem auf dem Land, leben immer mehr alte Menschen.
Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat im Frühjahr mit Faktoren wie Bevölkerungsstruktur, Wirtschaft, Bildung und Familienfreundlichkeit die Zukunftsfähigkeit deutscher Regionen analysiert. Unter den 100 Kreisen, die am besten aufgestellt sind, waren dabei nur sechs aus dem Osten.
Für weite Teile Sachsen-Anhalts, Vorpommerns und die Brandenburger Gebiete fernab von Berlin ist die Prognose schlecht, eine Abwärtsspirale droht. Vergleichbar problematisch sind laut Studie jedoch die Aussichten in einigen westdeutschen Regionen. Dort stehen Gebiete wie das Ruhrgebiet vor ähnlichen Herausforderungen wie ostdeutsche Kreise nach der Wiedervereinigung. Die Großstädte dagegen boomen, auch das ein gesamtdeutscher Trend, der sich im Osten spiegelt: Leipzig und Dresden, aber auch Jena und Erfurt wachsen seit Jahren.
In der Bevölkerungsstruktur gibt es dabei immer noch Unterschiede. So macht sich bemerkbar, dass in die Bonner Republik schon ab den 1950ern zahlreiche Menschen einwanderten: Während in Westdeutschland 2017 gut jeder Vierte einen Migrationshintergrund hatte, war es in Ostdeutschland gerade einmal jeder 15.
Von denen, die nach 1990 aus dem Westen kamen, machten viele in ostdeutschen Ländern Karriere. Spitzenposten in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sind daher häufig von Menschen besetzt, die aus dem Westen kommen. Im Jahr 2015 untersuchte die Universität Leipzig die Zusammensetzung ostdeutscher Eliten. Das Ergebnis: Von 1099 Positionen in Politik, Wirtschaft, Medien, Hochschulen und Justiz war nicht einmal ein Viertel mit Ostdeutschen besetzt. Die Studie ist aus dem Jahr 2015. Doch dass sich seitdem grundlegend etwas geändert hat, davon ist nicht auszugehen.
2019 sind von 25 Präsidentinnen und Präsidenten der obersten Gerichte in Ostdeutschland 25 aus Westdeutschland. Genauso sieht es an den Hochschulen aus: Nach einer Untersuchung von Anfang des Jahres wird nicht eine einzige Universität in Deutschland von jemandem geleitet, der aus Ostdeutschland stammt.
Politik
Das Engagement in den politischen Parteien ist in Ost und West verschieden groß. Während in Westdeutschland immer noch mehr als eine Million Menschen Mitglied einer politischen Partei sind, liegt die Zahl in den ostdeutschen Ländern nur bei rund 100.000 Mitgliedern.
Immerhin: Während die Zahlen im Westen weiter sinken, ist im Osten offenbar der harte Kern der politisch Engagierten erreicht. Zur besseren Vergleichbarkeit berechnet der Politikwissenschaftler Oskar Niedermeyer regelmäßig die „Rekrutierungsfähigkeit“ der Parteien: Damit wird der Teil der Bevölkerung erfasst, der (aufgrund des Alters) in eine Partei eintreten darf und dies dann auch tut.
Die ostdeutschen Flächenländer liegen dabei auf den hintersten Plätzen: In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern tritt nur weniger als ein Prozent der berechtigten Bevölkerung in eine Partei ein. In Thüringen ist es ein Prozent. Zum Vergleich: In Hessen, Niedersachsen und Bayern sind es zwei Prozent. Spitzenreiter – und Ausreißer – ist das Saarland mit 4,5 Prozent.
In Ostdeutschland ist auch das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie insgesamt weniger ausgeprägt: Laut einer aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ist in den ostdeutschen Ländern nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie – im Westen dagegen war es fast die Hälfte.
Und wie denken die Menschen selbst über ihre Lage? In beiden Teilen Deutschlands schätzten die meisten Menschen ihre Situation als positiv ein. In einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut INFO durchgeführt hat, gaben 79 Prozent der West- und 74 Prozent der Ostdeutschen an, insgesamt mit ihrem Leben zufrieden zu sein.
Allerdings: Vor der Wende lag dieser Wert in beiden Teilen des Landes etwas höher. Vor allem das Gefühl von sozialer Sicherheit hat dabei laut Befragung abgenommen. 89 Prozent der Teilnehmer, die die DDR erlebt hatten, gaben an, dass sie vor der Wende zufrieden gewesen seien mit der sozialen Sicherheit. Aktuell haben dieses Gefühl nur noch sechs von zehn Ostdeutschen. Auch die politische Gesamtsituation bewerten heute weniger Menschen als gut als noch vor 30 Jahren – das gilt auf beiden Seiten der ehemaligen Grenze.