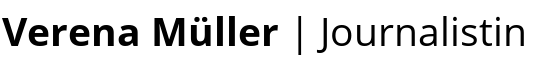Als wir Demokratie lernten
Viele DDR-Bürgerrechtler von 1989 taten sich lange schwer mit den Parteien. An ihnen zeigt sich: Es ist nicht einfach, aus Enthusiasmus Politik zu machen.
(Sächsische Zeitung, November 2019)

Gisela Kallenbach schwingt sich vom Fahrrad im Westen Leipzigs. Sie grüßt mit kräftigem Händedruck. Kallenbach, mit dunkler Rahmenbrille, knalligem Lippenstift, rotgefärbten Haaren, kämpfte zusammen mit anderen Aktivisten Ende der 1980er-Jahre in der DDR für Freiheit und Demokratie und verteilte Flugblätter während der Montagsdemonstrationen. Nach der Wende trat sie den Grünen bei. Damit ist sie bis heute eine der wenigen in Ostdeutschland, die einer Partei angehören.
Bei der SPD kommen ohne Berlin 4,9 Prozent aus dem Osten, bei der CDU 8,9 Prozent, bei den Grünen 7,4 Prozent – und das bei einem Anteil der Ostdeutschen von 17 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Selbst unter den ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern, die sich besonders für ein demokratisches System eingesetzt haben, war die Skepsis gegenüber Parteien lange groß.
Auch Gisela Kallenbach hatte es zunächst strikt abgelehnt, einer Partei beizutreten. Zu stark waren ihre Träume von der SED durchkreuzt worden. Als junge Frau wollte sie Karriere als Wissenschaftlerin machen, sich für Frauen in höheren Positionen einsetzen – aber dafür hätte sie Parteimitglied werden müssen. Als sie ablehnte, blieb ihr nur die Arbeit als Chemielaborantin. „Damit war ich natürlich erstmal null parteiaffin“, erklärt die heute 75-Jährige. Im Gegenteil, Parteien waren für sie immer „etwas Schmutziges“. Als Parteilose saß sie Anfang der 1990er-Jahre im Leipziger Stadtrat.
Schnell habe sie jedoch begriffen, dass man Politik nur über Parteien machen kann. Die Grünen waren die Einzigen, die überhaupt für sie infrage kamen. Wegen des Eintretens für die Menschenrechte und die Gleichstellung von Mann und Frau, wie sie sagt. Die PDS als „Nachfolgepartei der SED“ sei das „Letzte“ gewesen. Die CDU war ihr trotz ihrer Kirchenzugehörigkeit zu konservativ und inkonsequent beim Eintreten für die Schwachen. Die Grünen hätten bewusst den Kontakt zu ihnen, den früheren DDR-Bürgerrechtlern, gesucht.
Selbst unter den Bürgerrechtlern, die oft Tag und Nacht an den Runden Tischen für eine bessere Zukunft gearbeitet haben, wollten viele danach nicht ununterbrochen Politik machen. Als die wichtigste Arbeit getan war, kehrten sie entweder in ihre bürgerliche Arbeit zurück oder sie genossen, jetzt alles tun und werden zu können was sie wollten, ob Anwalt oder Arzt. Zudem, so drückt es später Uwe Schwabe vom „Archiv Bürgerbewegung“ aus, seien viele schlicht nicht bereit gewesen, Kompromisse einzugehen. Ihr vormals nützlicher Drang, Widerstand zu leisten, stand ihnen plötzlich im Weg. „Das waren ja größtenteils Individualisten und Idealisten.“
Gisela Kallenbach hat es 14 Jahre nach der Wende bis ins EU-Parlament geschafft – und ist damit eine von bisher acht Ostdeutschen überhaupt. Zuvor war sie drei Jahre im Kosovo. Im Rahmen eines UN-Einsatzes sollte sie die Verwaltung des Landes wiederaufbauen. „Wir hatten bewiesen, dass wir das können“, erklärt sie. Später war sie Abgeordnete im Sächsischen Landtag und Sprecherin für Umweltschutz und Europapolitik. Und das alles, obwohl sie in der DDR „nicht mal Abitur machen durfte“.
Geholfen habe ihr dabei die Bereitschaft, hohen Einsatz zu bringen, auch ohne viel Eigennutz, und immer wieder Neues zu lernen. Oft „für’n Appel und ’n Ei“, wie sie sagt. Demokratie habe man da ganz automatisch gelernt, sich zu arrangieren und zu akzeptieren. Und dass für manche Ideen die Zeit noch nicht reif ist. Schon 1992 hätten sie gefordert, die Städte nicht nur nach westdeutschem Vorbild nach dem Auto auszurichten, stattdessen Bus, Bahn und Fahrrad mehr Raum zu geben.
Durch die Westmedien habe sie von Anfang an gewusst, auch der Kapitalismus hat viele Haken. „Manche glaubten, es geht alles weiter wie bisher, bloß mit Westgeld, günstigen Reisen und bunten Waren.“ Sie sah hingegen die Chance, mitzugestalten. Zu lange habe sie das in der DDR mit viel Risiko eingefordert. In keiner Weise könne sie daher verstehen, wie manche ihrer ehemaligen Mitstreiter nur in der Vergangenheit lebten – oder gar mit der AfD anbändelten.
Die ewige Widerständlerin
Vera Lengsfeld macht im Gespräch keinen Hehl daraus, was sie über die heutige Gesellschaft denkt. Auf dem Weg in die „Gesinnungsdiktatur“ sei die. Lange habe sie geglaubt, die bürgerlichen Freiheiten seien mit dem Ende der DDR gesichert, vor allem die Meinungsfreiheit. Die abgesagten oder verhinderten Auftritte von Christian Lindner an der Uni Hamburg und Thomas de Maizière in Göttingen sind für sie aktuelle Belege, dass die von einer „radikalen Minderheit massiv“ bedroht sei. Mit staatlicher Gewalt müsse man zwar heute nicht mehr rechnen, dafür mit „Antifa-Gewalt“.
Vera Lengsfeld wirkt barsch in ihren Antworten, scheint sich als ewige Widerstandskämpferin zu sehen. Ihre Aussagen sind Angriff und Abwehr zugleich. Rhetorisch scheint sie sich selbst bei banalen Fragen im Kriegszustand zu befinden. Sie ist eine der bekanntesten ehemaligen Bürgerrechtlerinnen, gründete den Friedenskreis Pankow, moderierte Menschenrechtsseminare. Später wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zur Wahrheit gehört aber auch: Lengsfeld war selbst acht Jahre Mitglied der SED. Heute warnt sie vor einer „Unterwanderung des Rechtstaates“, der „Rückkehr von DDR-Strukturen“ und „linker Propaganda“. Seit 2014 tritt sie öffentlich als Kritikerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf und ist Initiatorin der „Gemeinsamen Erklärung 2018“, die sich gegen eine „Beschädigung Deutschlands“ durch eine „illegale Masseneinwanderung“ richtete.
Auch Lengsfeld trat wie viele ihrer damaligen Mitstreiter nach der Wende zunächst den Grünen bei. „Das war einfach logisch“, sagt sie heute rückblickend. Schon in der DDR engagierte sie sich bis zu ihrer Verhaftung 1988 in der Umweltbewegung, die sich auch bei ihr zuhause traf. Schnell musste sie jedoch feststellen, so die gebürtige Thüringerin, dass sich hier mit den Ost- und Westmitgliedern zwei Gruppen zusammenschlossen, die eigentlich nicht zusammengehörten. „Wir wollten alles Kommunistisch-Sozialistische abstreifen. Die Westgrünen waren aber von den ehemaligen K-Gruppen unterwandert und pro-SED eingestellt.“ Als „K-Gruppen“ wurden die kommunistischen Kaderorganisationen bezeichnet, die aus den Studentenbewegungen der 1960er-Jahre hervorgingen.
Auslöser die Partei zu verlassen und zur CDU zu wechseln, war für Lengsfeld damals die von ihr befürchtete Koalition der Grünen mit der damaligen PDS, die für sie „noch immer die alte SED“ war und es bis heute ist. „Ich habe nicht den besten Teil meines Lebens damit verbracht, gegen die SED zu kämpfen, um ihr dann wieder zur Macht zu verhelfen.“ Bis 2005 war sie Mitglied im Bundestag, zunächst für Bündnis 90/Die Grünen, dann für die CDU. Den Christdemokraten gehört sie bis heute an, obwohl sie auch die immer kritischer sehe, vor allem wegen deren „Anbiederung an die Linken“ wie es derzeit in Thüringen geschehe. Seit 2013 sympathisiert sie offen mit der AfD, trat zusammen mit Frauke Petry öffentlich auf und publizierte Beiträge in rechtskonservativen Medien wie Junge Freiheit oder Achse des Guten.
Man merkt ihr an, dass sie alles Linkspolitische rigoros ablehnt. Zu tief scheinen die Demütigungen zu sitzen, die ihr das sozialistische Regime zugefügt hat. Vor allem die Haft und die Tatsache, dass ihr eigener Ehemann, Knud Wollenberger, sie ausspähte und den Spitzeleinsatz um sie herum koordinierte. Andererseits, so gibt Lengsfeld heute zu verstehen, möchte sie die damalige Zeit nicht missen. Die habe sie gelehrt, mit Widerständen umzugehen und sich nicht einschüchtern zu lassen, wenn man gegen die „Einheitsmeinung“ verstoße. Das komme ihr jetzt zugute.
Persönlich sieht sich als eine der entscheidenden Gestalterinnen Ostdeutschlands in den vergangenen 30 Jahren, vor allem in den Anfangsjahren, „als das noch gut möglich war“. Als sie beginnt, von ihren Erfolgen zu erzählen, wird ihre Stimme milder. Zum
Beispiel von den zwei Nationalparks, für die sie sich einsetzte, dem Hainich in Thüringen und einem auf dem Darß an der Ostseeküste.
Der politische Parteilose
Ein Büro im Zentrum Leipzigs. Hier sitzt Uwe Schwabe, inzwischen 57, zwischen hohen Bücherstapeln, vergilbten Dokumenten und alten Protestplakaten und beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit den ehemaligen Bürgerrechtlern. Ein rotes Tuch seien Parteien für ihn und auch viele andere Menschen Ostdeutschlands gewesen. Der Schrecken der SED saß zu tief. Zwar hatte auch er sich kurzzeitig auf dem politischen Parkett der jungen Demokratie ausprobiert.
Er war Mitbegründer des Neuen Forums, jener Oppositionsbewegung in der DDR, die sich nach der Wende mit anderen Bürgerrechtsgruppen zum Bündnis 90 und später mit den Grünen zusammenschloss. Während der ersten freien Wahlen im Frühjahr 1990 versuchte er Themen zu setzen und sich Verbündete zu suchen. „Wir haben damals mit vielen gesprochen, von der SPD und CDU bis zu den damaligen Kleinparteien, um nach einem passenden Weg für die Zeit nach der DDR zu suchen.“Innerhalb kürzester Zeit habe er jedoch gemerkt, dass auch in einer Demokratie nicht alles rosig läuft: „Auch da macht Macht korrumpierbar.“ Seine Forderung etwa, die selbsternannten Sprecher des Neuen Forums müssten sich durch Wahlen legitimieren, stieß auf Ablehnung. „Die wollten nichts von ihrer Position abgeben.“ Hinzu kam für ihn das Auftreten der bestehenden westdeutschen Parteien.
Zwei Momente hätten ihn in dieser Zeit besonders geschult: Da war zum einen die Begegnung mit den westdeutschen Grünen Anfang 1990. Die traten zwar als Unterstützer des Neuen Forums auf. „Gleichzeitig kritisierten die uns aber für unsere Friedliche Revolution.“ Der Wunsch nach Wiedervereinigung, so ihr Tenor, würde Helmut Kohl an der Macht halten.
Zum anderen waren da die ersten Regionaltreffen des Neuen Forums. „Wir Jüngeren waren selber Lernende und hofften darauf, gemeinsam einen Weg zu finden.“ Stattdessen habe man ihnen vorgeworfen, nicht zu wissen, was man wolle. „Plötzlich hieß es von einigen, man müsse das Rad ja nicht neu erfinden, die Bundesrepublik gäbe es ja bereits und die funktioniere doch gut.“ Die am Runden Tisch erarbeitete Verfassung wurde vollständig abgelehnt. Aus Protest trat Schwabe im Mai 1990 aus dem Neuen Forum aus.
Die härteste Lektion seiner Demokratieausbildung? Vor wenigen Jahren, als Legida, der Leipziger Ableger von Pegida, montags durch die Straßen marschierte. Wie damit umgehen, fragte er sich. „Wir konnten die ja nicht alle pauschal als Nazis bezeichnen.“ Vielmehr wollte er wissen, warum die so dachten. Zusammen mit anderen ehemaligen Bürgerrechtlern veranstaltete er Gesprächsrunden an der Volkshochschule, bei denen die Leute frei und ohne Beurteilung ihre Meinung äußern konnten. Unglaublich schwer sei es gewesen, manche der Aussagen zu ertragen.
Derzeit sieht auch er die Demokratie besonders in Ostdeutschland an einem Tiefpunkt. „Die Vorstellung, es muss jemanden geben, der meine Probleme löst, steckt tief in den Leuten drin. In den vergangenen Jahren scheint die wieder aufgebrochen zu sein“, sagt er. Für ihn sei auch das eine Folge der SED-Diktatur. Man habe nicht gelernt, eigenverantwortlich zu sein. Und dann diese „absurde Diskussion“ um eine generelle Anerkennung der Lebensleistung der Ostdeutschen. Da redet sich Schwabe in Rage. „Ich will nicht die Leistung von jemandem anerkennen, der Menschen an der Grenze erschossen oder andere bespitzelt hat.“ Auch in ihm schlummert eben noch der Aktivst von einst.
Schwabe, Kallenbach, Lengsfeld – drei Aktivisten, die in der DDR für Freiheit und Demokratie eintraten und viel riskierten. Viel schien sie einst zu verbinden. Aber als das gemeinsame Feindbild wegfiel, hatte jeder eine andere Vorstellung davon, wie sich die Ziele erreichen lassen – und wie viele Abstriche er bereit war einzugehen. „Gemeinsam gegen eine Diktatur zu sein, ist natürlich erstmal einfach“, bringt es Schwabe auf den Punkt. Eine Demokratie zu verbessern sei hingegen ein schwieriger und langwieriger Prozess, der eines bis heute brauche: Mut.