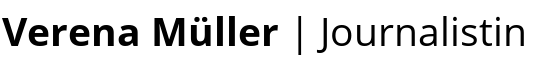Auf Gift gebaut
Bitterfeld, einst die dreckigste Stadt der DDR, gilt als eine Erfolgsgeschichte ökologischer Sanierung. Doch noch immer lauern unter der Oberfläche Tausende Tonnen Altlasten.
(DIE ZEIT, Dez. 2020)

Peggy Schlegel lebt am Wasser, sozusagen in der Wildnis – und trotzdem direkt in Bitterfeld. Fischreiher und Gänse, Wildschweine und Rehe gehören hier zum Alltag. Einfach toll sei es, sagt Schlegel, die seit 34 Jahren in dem Haus am See wohnt, mit ihrem Mann und zwei Töchtern, 19 und 15 Jahre alt. Auch ihre Schwester hat sich nebenan ein Haus gebaut. In einem Paradies, das noch vor drei Jahrzehnten einer der übelsten Orte der DDR war.
Wobei: Ist das wirklich ein See, an dem sie hier zu Hause ist? Ist das wirklich ein Paradies?
Nur 50 Meter von Peggy Schlegels Grundstück entfernt liegt der Silbersee. Jener berüchtigte Tümpel, in den die Orwo, die größte Filmfabrik der DDR, jahrzehntelang ihre Abwässer leitete. Ein silbrig-goldener, zäher Ölfilm glänzte an seiner Oberfläche. Heute schaut er fast wie ein normales Gewässer aus. Und Familie Schlegel kann den Wandel der Zeiten sozusagen vor der eigenen Haustür bestaunen.
Aber der See steht auch dafür, wie lange der Wandel in Bitterfeld dauert. Wie schwer es der Natur fällt, den Schmutz der Geschichte loszuwerden. Wie teuer das ist, wie viel Arbeit es benötigt. Bitterfeld gilt als Vorzeigestadt der ökologischen Sanierung, aber vieles ist bis heute nicht fertig. Der See riecht noch immer nach dem Gift, das in ihm lagert. Und manche sagen: Die Stadt wird viel länger mit den ökologischen Folgen der DDR kämpfen, als es die DDR gab.
Ende der 1980er-Jahre galt Bitterfeld als dreckigste Stadt Europas. Die Schauspielerin Jane Fonda, heißt es, habe geweint, als sie kurz nach dem Mauerfall für Filmaufnahmen herkam. Hier, in einem der Industriezentren der DDR, wurde die Wäsche gelb, wenn der Wind schlecht stand. Heute ist der einstige Schandfleck ein Sehnsuchtsort fürs Eigenheim im Grünen geworden. Wer zeigen will, wie sich der Osten verändert hat, zeigt auf Bitterfeld. Familien wie die Schlegels erzählen von einem Zuwachs an Lebensqualität, wie er einst unvorstellbar schien.
Aber unter der Oberfläche, im Wortsinn, warten noch immer die Probleme.
Man kann Fred Walkow treffen, um das zu verstehen. Walkow, 69 Jahre alt, ein Mann mit Vollbart und kräftiger Statur, steht ebenfalls am Ufer des Silbersees. Er war zu DDR-Zeiten selbst Chemiker in der Filmfabrik gewesen, nach der Wende wurde er Chef des Bitterfelder Umweltamtes. Und er ist, ja, stolz.
Unglaublich sei der Effekt der Sanierungen, fantastisch seien die Selbstheilungskräfte der Natur, seit die alte Chemie-Industrie hier abgewickelt wurde, sagt Walkow. Trotzdem solle man einmal genau auf den Geruch achten, der hier wahrzunehmen sei. Und ja: Es riecht nach faulem Ei. „Das ist Schwefelwasserstoff“, sagt Walkow. Ein eigentlich hochgiftiges Gas, es tritt noch immer aus dem See aus. 50 Jahre lang wurde der Silbersee, ein ehemaliges Tagebauloch, als Müllhalde genutzt. Noch immer liegen die Überreste der Nylon- und Dederon-, der Foto-, Kino- und Röntgenfilmproduktion am Boden der Grube. „Betreten verboten“ steht am Zaun.
Wenn man nicht gerade darin bade, sagt Walkow, sei der Silbersee inzwischen harmlos. Die Gase seien heute so stark verdünnt, dass es unbedenklich sei, sich am Ufer aufzuhalten. „Stinkt halt nur“, sagt er. Er zeigt auf einen Schwarm Graugänse. „Dass die hier sind“, sagt Walkow, „wäre früher undenkbar gewesen.“ Noch 20 Jahre soll es dauern, bis der See weitgehend unschädlich ist.
Walkow erinnert sich noch gut an den 26. Februar 1992. Damals fand in Bitterfeld die erste Umweltkonferenz im Ort nach dem Mauerfall statt. Erstmals sollte öffentlich gemacht werden, welches Ausmaß die Verschmutzung hier hatte. Man habe den Leuten gesagt: „Stellen Sie jetzt die Fragen, für die Sie früher nach Bautzen gekommen wären!“ Aber kaum ein Bitterfelder habe welche gestellt. Die meisten hätten sich eher geärgert, dass im Westen so viele Sprüche über die Stadt und den Dreck gemacht wurden. Sie hätten sich verunglimpft gefühlt.
Das Grundwasser ist zehntausendmal giftiger, als es die Norm erlaubt
Walkow dagegen begann, die Umweltschäden zu dokumentieren. Er notierte und fotografierte die toten Fische auf der Mulde, die abgestorbenen Bäume, die schwefelgelben Schlieren auf den mit Giftmüll gefüllten Kohlegruben. Er machte Fotos von Bitterfelder Bürgern, die auch außerhalb der Fabriken Atemmasken trugen, um die beißenden Dämpfe zu ertragen. Auch ihm, sagt er, sei erst spät klar geworden, was da vor seinen Augen passiert war. „Man selbst war ja scheinbar schon ziemlich abgestumpft.“
Dass es Bitterfeld heute wirtschaftlich gut geht, hat auch etwas damit zu tun, dass der Ort nicht mit seiner Geschichte gebrochen hat. Dass er versucht hat, das Beste aus der eigenen, schmutzigen Tradition zu machen. Man kann das mit Armin Schenk besprechen, dem CDU-Oberbürgermeister.
Wenige Fahrminuten vom Silbersee entfernt: weißer Kies, gestutzter Rasen, Buxbäume. Schenk sitzt im Garten einer renovierten Kaufmannsvilla, am Ufer der Goitzsche, des großen Sees von Bitterfeld, auch er ein altes Tagebauloch. Der Jachthafen ist nicht weit, im Hintergrund sieht man schwimmende Häuser, einen Badesteg. Schenk sagt: Einen „riesigen Turnaround“ habe Bitterfeld geschafft. Wer ihm zuhört, erfährt von einer brummenden Wirtschaft, von wachsendem Tourismus, von freien Jobs und Fachkräftemangel, den es heute gebe.
Weil Bitterfeld sich auch nach 1990 immer als Industriestandort verstanden habe, sagt Schenk, hätten sich viele neue Firmen angesiedelt. Dass die Menschen wie selbstverständlich bereit seien, im Drei-Schichten-System zu arbeiten, habe manche Investoren beeindruckt. Dort, wo einst das alte Chemiekombinat stand, gibt es auch heute wieder einen Chemiepark. 12.000 Menschen arbeiten in 300 Firmen. Heraeus produziert Quarzglas für Glasfaserkabel, Dow produziert Bindemittel für Lebens- und Arzneimittel. Und Bayer presst das Aspirin für die Welt.
Bitterfeld hat sich von der Chemie befreit – und sie trotzdem hergelockt.
Das Bitterfelder Zauberwort dabei lautet „Sanierung“. Einer, der es gern verwendet, heißt Ronald Basmer. Er leitet die Abteilung Altlasten der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH. Die Firma soll im Auftrag des Staates wiedergutmachen, was 150 Jahre Tagebau und vier Jahrzehnte DDR angerichtet haben. Basmer redet von ökologischen Großprojekten, von Brunnenriegeln und Schwermetallbelastungen. Die Leute, sagt Basmer, machten sich in Bitterfeld kaum noch Sorgen um ihre Gesundheit. „Das heißt, wir haben einen guten Job gemacht.“ Aber der sei längst nicht beendet.
In Bitterfeld gibt es ein ausgeklügeltes System aus Pumpen, Rohren und einem Klärwerk, das dafür gesorgt hat, dass das Grundwasser sauberer wurde. Bis heute bringen die Pumpen verschmutztes Grundwasser nach oben, Rohre leiten es quer durch die Stadt, das Klärwerk reinigt es. Gesäubert fließt es zurück in Mulde und Elbe. Etwa 2,3 Millionen Kubikmeter Dreckbrühe werden so im Jahr abgebaut, was rund 15 Millionen Euro jährlich kostet.
Und doch ist die Arbeit bei Weitem nicht erledigt. Schräg gegenüber vom Silbersee, in den Gruben Antonie und Greppin, befinden sich noch immer übelste Giftlager der Vorwendezeit. 60.000 Tonnen teils hochtoxischer Substanzen, bis heute nicht beräumt, ständig vom Grundwasser ausgewaschen, sorgen für eine fortschreitende ökologische Krise. 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser auf zehn Quadratkilometern gelten als unbrauchbar – das ist die Wassermenge von drei Talsperren. Ihr Gemüse sollen Bitterfelder, die in bestimmten Stadtteilen leben, noch immer nicht mit Wasser aus Brunnen gießen. Wildschweine und Rehe aus einigen Bereichen der Bitterfelder Muldeaue dürfen bis heute nicht auf den Teller. Schafe sollen an manchen Orten nicht weiden, Gras und Getreide nicht als Futter genutzt werden. Noch immer spült die Elbe Schadstoffe aus Bitterfeld in Hamburg an. Das Trinkwasser der Bitterfelder kommt per Fernleitung aus dem Harz. An einigen Stellen ist das Grundwasser zehntausendmal giftiger, als es die Trinkwassernorm erlaubt.
Wie behebt man das? Die Grube Antonie könnte ausgegraben, der giftige Untergrund entsorgt werden. Aber verseucht ist eine riesige Fläche, 40 Quadratkilometer groß. Ein Teil der Stadt sei darauf errichtet. Die könne man ja schlecht abreißen, sagt Basmer. „Und wohin mit hundert Millionen Kubikmeter Abfall?“ Erst mal soll eine unterirdische Mauer gebaut werden, 650 Meter lang, einen Meter dick, bis zu 35 Meter tief. Sie soll Grundwasser anstauen und verhindern, dass der Giftschlamm aus den Gruben hineinläuft.
Bitterfeld ist ein Projekt für die Ewigkeit.