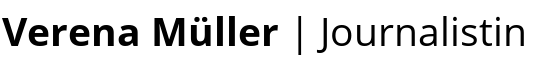Außen stark, innen ganz krank
Die Angst zu versagen, ist das häufigste Problem, mit dem Männer zu Therapeut Björn Süfke kommen. Depressionen bleiben bei dem noch immer als „stark“ geltenden Geschlecht oft unerkannt – mit Folgen. Sie begehen häufiger Suizid als Frauen.
(u. a. Berliner Morgenpost, September 2019)

Alles fing an mit Schlafstörungen. Viele Tage schon hatte Sebastian Keck kaum geschlafen, wachte morgens mit Herzrasen auf, dazu kam der Brechwürgereiz. Irgendwann hatte er Angst, gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Panikattacken überkamen ihn. Er glaubte, verrückt zu werden.
Keck ist Inhaber einer gut laufenden Marketingagentur. Er hat eine Frau und eine kleine Tochter. Alles scheint perfekt.„Aber nur nach außen“, sagt Keck heute. Die neue Verantwortung als Vater, gleichzeitig in der Agentur der bis dahin größte Kunde – er versucht, alles richtig zu machen, keine Schwäche zu zeigen. Er raucht immer mehr, um sich zu beruhigen, wird aber von Tag zu Tag dünnhäutiger. Bis es einen Monat später nicht mehr geht. Er lässt sich in die „Klappse“ einweisen, wie er es nennt, obwohl er nie zu denen gehören wollte, die „es nicht geschafft haben“. Die Diagnose: generalisierte Angststörung und Depression.
Die tiefe Angst zu versagen ist eines der häufigsten Probleme, mit dem Patienten zu Björn Süfke in die Praxis in Bielefeld kommen. Süfke ist Männertherapeut. Er sagt, er hat sich auf die psychischen Leiden „des immer als stark geltenden Geschlechts“ spezialisiert. Selbst wenn sich die klassischen Stereotype langsam auflösten und man sich deren bewusst sei, steckten die in vielen noch sehr tief drin, „zu tief“. Mädchen seien von klein auf noch immer oft die Prinzessinnen, Jungs die Racker. Später, so Süfke, drehe sich bei vielen Männern noch immer alles darum, ständig leisten zu müssen, die Familie zu versorgen, den funktionierenden Macher zu geben.
Zwar leiden auch viele Frauen unter sozialisationsbedingten Ängsten. Sie fühlten sich meist nicht schön oder beliebt genug, sagt Süffke. „Die haben aber mehr gelernt, darüber zu sprechen. Und vor allem, sich Hilfe zu suchen, bevor es zu spät ist.“ Viele Männer kämen erst, „wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“. Die Lebensgefährtin trennt sich oder die körperlichen Beschwerden werden so stark, dass der Arzt sie schickt. Die meisten verdrängten, wie stark sie etwa unter dem Leistungsdruck litten, sagt Süfke. Häufig unbewusst. Gefühle könne man so stark abspalten, dass man nichts davon wahrnimmt. „Bis irgendwann Murks rauskommt.“ Also Aggressionen, Gewalt und antisoziales Verhalten, Flucht in die Arbeit, in Alkohol oder Drogen, bis hin zum Suizid.
Auch die Ärzte werden durch ihre eigenen Stereotype geleitet
„Viele der Betroffenen wissen nicht, dass dahinter eigentlich eine Depression steckt“, sagt Anne-Maria Möller-Leimkühler von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Selbst Ärzte würden die Krankheit bei Männern deutlich seltener erkennen als bei weiblichen Leidensgenossinnen, erklärt die Professorin, die sich seit vielen Jahren mit den Geschlechterunterschieden bei psychischen Krankheiten beschäftigt. Der Grund: Viele zeigen nicht die typischen Anzeichen einer Depression, sind nicht niedergeschlagen oder antriebslos. Im Gegenteil, sie neigen eher zu Aktionismus, der häufig die depressiven Symptome überlagert. Die Wissenschaftlerin geht davon aus, dass die Krankheit bei Männern systematisch unterdiagnostiziert wird – auch, weil viele Ärzte durch ihre eigenen Stereotype geleitet würden. Hinzu kommt, dass Männer deutlich weniger wegen psychischer Probleme zum Arzt gehen.
Möller-Leimkühler hat daher einen Fragebogen entwickelt, der sich speziell an Männer richtet. Der geht nicht nur die klassischen Signale einer Depression durch. Er fragt auch danach, ob man mehr Alkohol trinkt, risikofreudiger Auto fährt, zu gesteigertem Aktionismus bei Sport, Arbeit oder Sex neigt. Überschreitet die Punktzahl einen Schwellenwert, kann das auf eine Depression hinweisen. Eine Untersuchung mit über tausend Patienten eines Berliner Gesundheitszentrums hat gezeigt, dass so deutlich mehr Fälle erkannt werden.
Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe wird in Deutschland jedes Jahr bei 5,3 Millionen Menschen eine Depression diagnostiziert. Mehr als jede zehnte Frau ist demnach davon betroffen – mehr als doppelt so viele wie Männer. Anders sieht es hingegen bei den Suiziden aus. Etwa drei Viertel der jährlich knapp 10.000 Suizide in Deutschlandwerden von Männern begangen, meist infolge einer depressiven Krankheit.
Schulterzucken – das sei häufig die erste Reaktion seiner Patienten auf die Frage, wie es ihnen geht, so Therapeut Süfke. Sie wüssten es oft einfach nicht. Angst, Trauer und Schmerz zu spüren, sei ihnen abtrainiert worden. „Da muss erst mal der Zugang neu gelegt werden.“ Süfke nutzt dazu das „Prinzip der liebevollen Konfrontation“. Er führe seinen Patienten „krass“ vor Augen, wie die ihre Gefühle abwehrten. Gleichzeitig begegne er ihnen mit „viel Einfühlsamkeit“, indem er ihnen das Gefühl gebe, „den ganzen Scheiß“ auch zu kennen. „Jetzt müssen wir lernen, damit umzugehen“, sagt er.
Auch Sebastian Keck konnte anfangs in der Klinik nicht sagen, was es war, wovor er Angst hatte. „Das war ein großes Knäuel, das langsam entwirrt werden musste.“ Vieles hatte sich angestaut. Der Vater hatte immer Härte eingefordert, die der wiederum von seinem Vater übernommen hatte. Mit der Geburt seiner Tochter sei das Fass, so der 37-Jährige, übergelaufen. Zwölf Jahre hatte er nicht geweint, in der Therapie jeden Tag. Über seine Zeit in der Klinik hat Keck ein Buch geschrieben, „Meine beschissene Angst“. Er wollte mit einem Tabu brechen. Viele in der Therapie hätten eine so große Scham empfunden, dass sie den Aufenthalt vor ihrer Familie verheimlichten.
Manche griffen auch zum Begriff „Burn-out“, der zwar nicht bei der Krankenkasse geführt wird, ihnen aber das Gefühl gibt, nur so viel geleistet zu haben, bis sie ausgebrannt waren. Auch seine Eltern hätten bis heute ein Problem damit, dass der erfolgreiche Sohn plötzlich einbricht. „Zur Beruhigung haben die den Bürgermeister herangezogen, der ja ebenfalls ein Burn-out hatte.“
Soziologin Möller-Leimkühler ist dennoch zuversichtlich. Die voranschreitende Frauenemanzipation weiche Geschlechternormen weiter auf, viele psychische Leiden würden so gelindert. „Das Gehirn“, so die Professorin, „wirkt immer so, wie man es auf Dauer benutzt.“