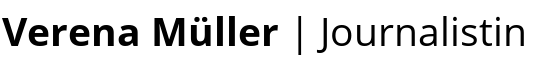Es riecht nach Molch
Will man wissen, wo gefährdete Arten noch vorkommen, brauchte es bislang meist viel Geduld. Spürhunde sollen die jetzt schneller und gründlicher erschnuppern. Nur, wie finden die eigentlich einen scheinbar geruchslosen Schwanzlurch?
(Die WELT, April 2021)

Es liegt in der Natur der Sache, wenn seltene Tiere und Pflanzen vor allem eines sind: schwer zu finden. Über ihr Dasein und Vorkommen ordentlich Buch zu führen, fällt deshalb oft nicht eben leicht. Kaum zu sagen, wieviele Fischotter es in Deutschland gibt, wo sich der Kammmolch am liebsten aufhält, und wo die Wechselkröte noch lebt? Und will man die wenigen verbliebenen Exemplare schützen, muss man ihre Biotope kennen und ihren Bestand, um einschätzen zu können, wie ernst es um sie steht. Dazu muss man sie aber erstmal aufstöbern. Also zurück zum Anfang: suchen und finden sind zweierlei.
Molche etwa, diese Schwanzlurche, wandern zur Fortpflanzung in Tümpel und Teiche und verbringen ansonsten den Großteil des Jahres in ihren unterirdischen Bauten. Sie zu entdecken, ist bislang ein mühsames Geschäft. Mit bloßem Auge suchen Forscher und Natur-Freunde nach ihnen, drehen Steine und Hölzer um. Nachts, im April und Mai zieht man mit Taschenlampen los, um sie mit viel Glück in dem Moment zu erwischen, in dem sie ins Wasser umziehen. Diese Molch-Suche dauert nicht nur sehr lange, sie ist auch noch ungenau.
Seit einiger Zeit setzen daher Naturschützer auf die Praktiken der Polizei. Sie nutzen Spürhunde. Spezialisieren die sich beim Zoll auf Drogen, sind es in Wald und Wiesen seltene Spezies. Laut einer aktuellen Studie haben die Tiere bereits bei mehr als 400 Arten mitgeholfen – vor allem bei Säugetieren, aber auch Vögeln, Reptilien, Amphibien und Insekten. In fast 90 Prozent der Fälle waren sie dabei erfolgreicher als andere Methoden, etwa Wildtierkameras oder Drohnen. Und das, ohne in den Lebensraum einzugreifen. Wollte man bislang etwa Käfer im Totholz ausmachen, musste man die abgestorbenen Stümpfe und Stämme aufbrechen, ihr empfindliches Milieu stören. Mit Hund ist das nicht nötig. Der zeigt vor dem Holz an, „Zielobjekt vernommen“.
Nur, wie bringt man eigentlich einen Hund dazu, ausgerechnet nach Molch, Käfer oder Kröte zu schnüffeln?
Ein Waldstück bei Grimma, östlich von Leipzig. „So mein Jung‘“, murmelt Annegret Grimm-Seyfarth. Neben ihr der Bach, zwischen alten Buchen und Erlen. Es riecht nach feuchter Erde, der Frühling sprießt aus allen Poren. Molchrevier. Grimm-Seyfarth ist Biologin am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und eine der Vorreiterinnen hierzulande, was Artenspürhunde anbelangt. „Monitoring Dogs“ prangt auf ihrer Jacke. Zwischen ihren Beinen klemmt Zammy, ihr 5-jähriger Border Collie. Der kam als Welpe zu ihr, seitdem hat sie ihn selbst zum Spürhund ausgebildet hat. Wieviel ein derart geübtes Tier heute kosten würde, lässt sich schwer sagen. Bei Polizeispürhunden können es schonmal bis zu 15.000 Euro sein. Auch dort setzt man häufig auf Collies – solange sie nicht zusätzlich mannscharf reagieren sollen, also aggressiv gegenüber Menschen. Sie sind zwar keine typischen Jagdhunde, ihre Nase liegt im Vergleich zu Beagles nur im Mittelfeld. Sie gelten aber als besonders motiviert, arbeiten am liebsten mit anderen zusammen.
Beim Zielgeruch gibt’s „’ne Riesenparty“
Auch auf Zammys Weste leuchtet das gemeinsame Team-Logo. Mit ihm will Grimm-Seyfarth hier im Muldental herausfinden, wo sich die Molche verstecken, die Teich-, Kamm- und Bergmolche. verstecken. „Wir müssen dringend mehr über diese Arten wissen“, sagt die 32-Jährige. „Aber dazu müssen wir sie erst einmal finden.“ Die drei Molcharten gelten in vielen Regionen Deutschlands als gefährdet oder stark gefährdet, seit Jahren stehen sie auf der Roten Artenliste. Von einem echten Amphibiensterben wird seit einigen Jahren gesprochen, ausgelöst hauptsächlich durch die schwindenden Lebensräume.
Vor allem über die Verstecke an Land weiß man zu wenig – obwohl Molche dort ihre meiste Zeit verbringen. Entsprechend wenig sind die bislang geschützt. Grimm-Seyfarth will daher herausfinden, wie die Biotope genau aussehen müssen, damit es den Tieren gut geht. Wie warm, feucht muss es sein, welche Pflanzen braucht es? Aus den Daten entwickelt sie Modelle, mit denen sich dann allein anhand der örtlichen Klimafaktoren entscheiden lässt, ob ein Gebiet molchgeeignet oder nicht. So muss man nicht jeden Ort, ob in Süddeutschland oder Südfrankreich, erneut mühsam nach den Tieren absuchen.
Mit zwei Fingern und einem „check“ signalisiert sie Zammy, es geht los. Zammy jagt davon, schnüffelt an jedem lebenden Baum, jedem toten Stamm, jeder Kuhle in Sichtweite, links des Weges. Alle diese Stellen per Auge und Hand selbst abzugrasen, hätte ungleich länger gedauert. „Nichts gefunden“ bedeutet Zammy ihr, als er zurückkehrt. Weiter geht’s, nächster Abschnitt. Man müsse dem Hund klarmachen, so Grimm-Seyfarth, „Molchgeruch“ sei das „Geilste in seinem Leben“. Und Ottergeruch. Zammy ist neben den Molchen auch auf Fischotter eingespielt. Erschnüffelt er einen seiner sogenannten Zielgerüche, gibt’s „’ne Riesenparty“. Soll heißen: Stöbert er ein Exemplar auf, bekommt er den liebsten Ball zum Spielen, die leckerste Wurst zum Fressen, meist ungesalzene Jagdwurst. Besondere Belohnungen, die es nur bei erfolgreich getaner Arbeit gibt.
Das Prinzip dahinter nennt sich Konditionierung. Dabei ist es egal, ob es um seltene Arten und Pflanzen oder um Drogen und Sprengstoff geht. Auf einen bestimmten Reiz – den Geruch –, erfolgt immer die gleiche Reaktion, die Euphorie. Gerade bei Hunden lässt sich mit Training viel über Emotionen steuern. Der Grund: Riechen die Tiere etwas, strömen die Signale auf dem Weg ins Riechzentrum zuerst an dem Teil des Gehirns vorbei, der Emotionen verarbeitet. Der Geruch „Molch“ oder „Otter“ ist dann mit „Jubel“ verknüpft. Tritt der in die Hundenase, setzt er sich vor die Duftquelle, in Erwartung, belohnt zu werden.
Drei Monate dauert es etwa, bis ein Hund das Schema verinnerlicht und zuverlässig auf den Zielgeruch anspringt. Zuerst wird mit toten Exemplaren trainiert. Oder, ganz am Anfang, mit einem Teebeutel. Damit lernt das Tier zunächst, überhaupt anzuspringen, wenn ihm ein bestimmter Duft in die Schnauze tritt. Frauchen oder Herrchen jubeln in dem Falle schon dann, wenn er allein am Beutel schnüffelt. Und dazu auch hier als Belohnung: Jede Menge Wurst.
Kann man sich darauf verlassen, dass der Spürhund nicht zupackt, sobald er eines der Wesen erspäht, darf er mit auf Molch-Tour.
Selbst tote Molche können Hunde erschnüffeln
Nach was so ein Molch eigentlich riecht? Für Menschen mit ungefähr sechs Millionen Geruchsrezeptoren nach nicht viel. Für Hundenasen vermutlich nach intensivem Sekret. Genau weiß man das nicht. Ein Hütehund besitzt mehr als 200 Millionen Geruchsrezeptoren, ein Beagle sogar 300 Millionen. Kot von Tieren in einem Wald zu finden oder Pilze unter der Erde zu erschnüffeln, ist für Hunde kein Problem. Selbst tote Molche können sie noch entdecken. Dazu das gute Gedächtnis. Mit ein bisschen Übung suchen Hunde nach bis zu 25 verschiedenen Gerüchen gleichzeitig. Allein, wenn es sehr trocken und heiß ist oder der Wind stark weht, kann es schwer werden, die Molchspur aufzunehmen.
Plötzlich stoppt Zammy, setzt sich an den Fuß einer Buche, die sich quer über den Bach geworfen hat. „Da ist was“, meldet er.
Und tatsächlich, eine Grube, von der sich ein schmaler Tunnel tiefer unter den Stamm gräbt. Annegret Grimm-Seyfarth ist sich sicher: Ein Molchquartier. „Wahrscheinlich ein Teichmolch.“ Exakt sagen kann sie das von außen nicht. Oft leite sich das aber davon ab, wo die einzelnen Arten verbreitet sind, sagt sie. Manchmal hilft ihr ein Endoskop, mit dem sie, ähnlich wie in die Gänge eines Darms, in die der Molche schauen kann. Und dann: Die Riesenparty! Freude, sein gelber Gummiball mit den Noppen fliegt, dazu heute Trockenfleisch statt Jagdwurst.
In Neuseeland seit 130 Jahren im Einsatz
Eigentlich macht Grimm-Seyfarth etwas, das es seit mindestens 130 Jahren gibt. Damals hatte man in Neuseeland damit begonnen, die flugunfähigen Kiwis, Schnepfenstrauße, mithilfe von Hunden aufzuspüren. Auf entlegenere Inseln wollte man die Vögel bringen, um sie auf den Hauptinseln vor den eingeschleppten Katzen und Wieseln zu schützen. Heute setzen in Neuseeland und in einigen anderen Ländern staatliche Behörden ganze Hundestaffeln ein, um ihre heimische Flora und Fauna zu erfassen. Selbst mieten kann man sich mancherorts einen Hund, der auf bestimmte Arten anspringt.

In Deutschland setzen sich die Spürnasen erst seit wenigen Jahren durch. Grimm-Seyfarth glaubt, weil man endlich auch hier die Vorzüge entdeckt hat. Dazu das wachsende Interesse an Naturschutz. Will man wissen, welche Arten wo und in welcher Größenordnung existieren, es gäbe kaum Alternativen.
Doch nicht nur Wissenschaftler nutzen hierzulande die Tiere. Auch immer mehr Planungsbüros. Etwa, um unter Windkraftanlagen die Vögel und Fledermäuse zu zählen, die durch sie draufgegangen sind. In vielen Bundesländern sind die Betreiber von Windparks dazu verpflichtet, diese „Schlagopfer“ zu notieren, wie sie offiziell heißen. Und das mindestens ein Jahr lang nach der Einweihung, zu verschiedenen Tageszeiten, im Umkreis von bis zu 80 Metern. Findet man zuviele Opfer und darunter auch noch geschützte Arten, muss nachjustiert werden, die Anlage in bestimmten Zeiten oder gar ganz gestoppt zu werden.
Das Schwierige beim Zählen: die Windräder sind oft von Mais oder anderen mindestens mannshohen Getreiden umgeben. Als menschlicher Sucher hat man da kaum eine Chance, zwischen den Pflanzen alle Tiere zu finden. Auch hier heißt es vom Spürhunde-Einsatz, sie brauchten nur ein Drittel der Zeit und sind wesentlich genauer. Selbst Reste von Flügeln lassen sich so finden.
Und im Grimmaer Wald? Weiß man jetzt, die Molche mögen’s besonders unter den alten großen Bäumen, unter totem Holz, in den Bauten von Nagern oder Füchsen. Diese Orte, die auch in heißen Sommern kühl und feucht sind, braucht es, damit sie gut leben und genügend Insekten, Würmer, Schnecken finden. Nur dann sind sie ausreichend gewappnet für das, was dann von Ende April bis Ende Juni im Wasser ansteht: Die Fortpflanzung.
Ein „mega Aufwand“, sagt Grimm-Seyfarth. Der Nachwuchs durchläuft eine vollständige Verwandlung von der Larve zum erwachsenen Molch. Dafür braucht er genügend Reserven. Fühlten sich die Tiere jedoch nicht fit genug, erklärt sie, warteten die erstmal ab mit dem Vermehren. „Ansonsten verausgaben die sich und sterben.“ Das bedeutet aber auch: Je länger die Pause, desto schlechter ist es um den Bestand der Art bestellt. Grimm-Seyfarth ist dennoch vorsichtig optimistisch: „Jetzt, wo wir ihre Sommerresidenzen kennen, können wir sie hoffentlich auch besser schützen.“