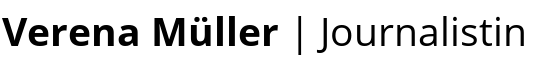Evolution mit Doping
Inseln sind Labore der Artenbildung. Sie ermöglichen Experimente bei Pflanzen und Tieren, die so auf dem Festland nicht möglich wären. Echsen oder Säugetiere werden riesig oder verzwergen, eine Spezies bildet mit der Zeit Tausende neue. Auf Inseln läuft die Evolution nicht, sie rennt – als ob Doping im Spiel wäre.
(NATUR, November 2017)

Das Wasser ist angenehm warm und für einen Süßwassersee ziemlich klar. Fast 30 Meter weit kann man hier an manchen Stellen sehen. Matthias Glaubrecht, Professor für Evolutionssystematik an der Universität Hamburg, gleitet in seinem Neoprenanzug durch das Wasser des Sees in der Mitte von Sulawesi, einer Insel im Norden Indonesiens. Die Augen auf den Untergrund gerichtet, in der Hand drei Gefäße mit der Aufschrift „Holz“, „Schlamm“ und „Fels“. Darin der Grund seiner Tauchgänge: Süßwasserschnecken, wenige Zentimeter groß, braunes Gehäuse, gelber oder grauer Körper. So unscheinbar ihr Äußeres, so imposant auch die Frage, die sie beantworten sollen: Wie entsteht eigentlich eine neue Art?
Glaubrecht kommt seit beinahe 20 Jahren nach Sulawesi um Thylomelania zu untersuchen, eine Gattung von Süßwasserschnecken, die nur dort lebt – in abgelegenen Seen und Flüssen im Inneren des Eilands. Sie sind die perfekten Kandidaten, um die biologischen Vorgänge beim Werden und Wandeln von Arten zu verstehen. Glaubrecht nennt sie beinahe liebevoll die Darwinfinken des Wassers.
Tausende von Süßwasserschnecken haben Glaubrecht und seine Forscherkollegen auf Sulawesi gesammelt und festgestellt: In den Seen haben sich überraschend viele neue Schneckenarten gebildet. Entscheidender Unterschied ist dabei ihre Raspelzunge und die darauf sitzenden Zähne. „Was bei den Finken auf Galapagos die Schnäbel, sind hier die Mundwerkzeuge der Schnecken.“ Die Finken des Galapagos-Archipels sind eines der bekanntesten Beispiele aus der Evolutionsforschung, denn sie haben, je nach Nahrungserwerb, ganz unterschiedliche Schnäbel ausgebildet. Das fiel bereits dem Begründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, im 19. Jahrhundert auf.
Jedem seine Raspelzunge
Auf Sulawesi leben auf kleinstem Raum, innerhalb eines Sees, dicht nebeneinander, einige Arten der Süßwasserschnecken auf Schlamm, andere auf Felsen, wieder andere auf versunkenen Baumstämmen. Von klein und spitz bis groß und abgerundet – je nach bevorzugtem Gefilde – zeigen sie feine Unterschiede in ihren mit Zähnen besetzten Zungen, mit denen sie ihre Nahrung vom Untergrund abschaben. Zwar ernähren sich alle Thylomenia von kleinen Algen und Bakterien, die am Ufer und am Grund wachsen. Offenbar haben sie aber alle ihre Nische für sich gefunden.
Das Interessante dabei: Die Unterschiede zeigen sich nicht nur zwischen verschiedenen Arten der Schnecken, sondern auch innerhalb einer einzigen Spezies. Bis zu fünf verschiedene Zungenvarianten je Schneckenspezies haben Glaubrecht und sein Team bisher entdeckt. Je nachdem, wo und wie diese leben, zeigen sich bereits Unterschiede in ihrem Erbgut. Die Holz-, Felsen- und Schlammbewohner unterscheiden sich demnach bereits deutlich in ihrer genetischen Ausstattung. Während einige dabei noch derselben Art angehören, ist bei anderen die ökologische und genetische Abschottung voneinander schon weit fortgeschritten. Klare Hinweise darauf, dass hier gerade neue Arten entstehen, die sich zusehends auseinanderleben.
Die verschiedenen Gruppen von Tieren frönen so lange unterschiedlichen Lebensgewohnheiten, bis die Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen so groß sind, dass sie gemeinsam keine fruchtbaren Nachkommen mehr hervorbringen können. Dann ist jener magische Darwin‘sche Moment gekommen: neue Arten sind entstanden. Nicht nur Gebirge, Landzungen oder andere geografische Barrieren können demnach zu neuen Arten führen, sondern auch unterschiedliches Verhalten in ein und demselben Lebensraum.
„Man muss die Entwicklung neuer Arten dort untersuchen, wo die Evolution besonders aktiv ist“, so Glaubrechts Credo. Und das ist bei den Schnecken auf Sulawesi der Fall. Allein dort haben sich Schätzungen des Biologen zufolge mehr als 70 Arten gebildet. Noch können die Forscher aber nicht voraussagen, wann es jeweils soweit ist und eine neue Art entsteht. Auch der genetische Abstand zwischen zwei Populationen für sich allein genommen verrät ihnen dazu kaum etwas. Laut Glaubrecht taugt er, entgegen der Hoffnung vieler Wissenschaftler, kaum als eine Art molekulare Uhr. „Es gibt keine fixe Rate, nach der Artenbildung abläuft.“
Aufschlussreicher sei da schon die Geologie Sulawesis. Demnach sind die Seen vor etwa einer Million Jahre entstanden, in der Zeitrechnung der Evolution ein Wimpernschlag, in dem alle Thylomenia- Arten entstanden seien. „Dabei entwickelt sich niemals nur eine neue Spezies, sondern immer mindestens zwei. Aus einer mach zwei, indem sich die ursprüngliche aufspaltet. Wir sprechen hier von der sogenannten Radiation“, erklärt Glaubrecht eine der Grundregeln der Artenbildung.
Freie Räume für Neuankömmlinge
Und das geschieht auf Inseln deutlich häufiger als auf dem Festland. Ein Grund: Dort treffen Neuankömmlinge wegen der abgeschiedenen Lage meist auf deutlich weniger vergleichbare Arten, viele ökologische Nischen sind also noch unbesetzt. Das öffnet Entwicklungsmöglichkeiten, beispielsweise bei den Nahrungsquellen. Daneben können sich die Lebensbedingungen aber auch erheblich von denen des Ursprungsgebietes unterscheiden. So fanden die Vorfahren der Galapagosechsen offensichtlich nicht genügend Nahrung an Land, so dass sie sich nach und nach zu Algenfressern und den einzigen im Meer tauchenden Leguanen entwickelten.
Die Galapagosschildkröten wiederum lernten auf den unterschiedlichen Inseln des Archipels die verschiedenen reichlich vorhandenen Nahrungsquellen zu nutzen. Manche entwickelten lange Hälse und einen nach oben gebogenen Panzer, um die hoch wachsenden Kakteen fressen zu können, andere verlegten sich auf dicht am Boden sprießende Nahrung und behielten den eher üblichen Schildkrötenpanzer. Häufig fehlen auf Inseln auch Räuber, so dass manche Spezies im Laufe der Entwicklung die Fähigkeit zur Flucht schlichtweg verlieren. So werden manche Vögel auf Inseln einfach flugunfähig, wie die Galapagosscharbe oder der Kiwi auf Neuseeland.
Alleine diese Besonderheiten machen Inseln bereits zu Versuchslaboren der Evolution mit einer erstaunlichen Artenfülle. Obwohl Inseln weltweit nur fünf Prozent der Landmassen ausmachen, leben dort rund 20 Prozent aller Pflanzen- und Tierarten. Besonders aktiv ist die Evolution auf den sehr weit vom Festland entfernten Fleckchen Erde. Auf Hawaii etwa, der entlegensten Inselgruppe der Welt, sind aus weniger als 1000 eingewanderten Arten 10 000 bis 15 000 endemische Spezies entstanden. Sie kommen nur dort und nirgends sonst auf der Welt vor. Die Fruchtfliegen der Inselgruppe gelten mittlerweile als eines der Paradebeispiele für Evolution auf Eilanden: Mehr als 1000 Arten der Drosophila sind hier aus einem oder ganz wenigen Vorfahren entstanden, wie genetische Analysen zeigen.
Wer schafft es wohin?
Doch wer oder was entscheidet überhaupt darüber, welche und wie viele Arten sich auf einer Insel dauerhaft niederlassen? Ein vergleichsweise einfacher Zusammenhang besteht zwischen der Landmasse einer Insel und ihrer Artenvielfalt: Je größer eine Insel, desto mehr Einwanderer können dort Fuß fassen und sich weiterentwickeln. Jedoch mit vielen Ausnahmen: Die Vielfalt hängt weiterhin davon ab, wie abwechslungsreich die Landschaft ist, wie weit es bis zum nächsten Festland und den Nachbarinseln ist, auf welcher geografischen Breite die Insel liegt oder wie alt das Eiland ist.
Bereits 1967 stellte Edward O. Wilson, einer der bekanntesten Evolutionsbiologen, seine Theorie auf, nach der sich auf jeder Insel ein Gleichgewicht zwischen Einwanderungs- und Aussterberate einstellt. Je mehr Arten bereits auf einer Insel existieren, je entfernter sie zum nächsten Festland liegt und je kleiner sie ist, desto weniger neue wandern ein. Umgekehrt verhält es sich mit der Zahl der Arten, die aussterben.
Wenn eine Insel aus dem Meer erwächst
Und wer ist der erste Pionier, wenn eine neue Insel aus dem Wasser herausragt? „Jüngst ist hier in der Nordsee eine neue Insel entstanden“, ruft Michael Kleyer im Watt vor Spiekeroog und lässt den Blick in die Ferne schweifen. Wind und Wasser haben hier aus einer Sandbank eine Düneninsel zusammengeschoben. „Wer werden wohl die ersten Bewohner darauf sein?“, fragt er. Kleyer ist Professor am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften an der Universität Oldenburg und beschäftigt sich in seiner Forschung damit, wer sich als erster in neu entstandenen, abgelegenen Lebensräumen niederlässt. Dabei interessiert ihn nicht, welche Arten rein zufällig auf ein neues Eiland gelangen, sondern vielmehr die allgemeinen Regeln dahinter.
Kein einfaches Unterfangen. Denn Inseln entstehen nicht ständig neu. Das neu entstandene Inselchen in der Nordsee ist eher eine Ausnahme. Außerdem unterscheiden sich jeweils die Bedingungen, so dass sich häufig kaum feststellen lässt, wo der pure Zufall die größte Rolle spielt – und welche Abläufe sich tatsächlich verallgemeinern lassen.
Um dieses Dilemma zu umgehen, schuf Ökologe Kleyer kurzerhand seine eigenen Inseln. Zwölf große Metallkästen im Watt vor der Nordseeinsel Spiekeroog, je fünf Meter lang, zwei Meter breit. Wie gestrandete Raumschiffe liegen sie da. Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, worum es sich handelt –und auch auf den zweiten lässt sich kaum mutmaßen, was diese Boxen aus Schiffsstahl, gefüllt mit Wattsand hier machen.„Wir haben den ganzen Entstehungsprozess einer Insel im Watt auf einen Schlag abgekürzt“, erklärt Kleyer, während er von einer Box zur nächsten watet. Auf mehr als 120 Quadratmetern künstlicher Inseln wollen die Forscher hier live mitverfolgen, wie aus einem marinen ein terrestrisches Ökosystem entsteht.
Dabei wollen sie verstehen, welche Arten sich auf Inseln etablieren können und warum. Und was eigentlich geschieht, wenn plötzlich eine neue Art eindringt. Kleyer interessieren dabei vor allem die Pflanzen, die sich hier vor den Tieren ansiedeln. Der Blick in die Metallboxen zeigt: Es hat sich schon einiges getan, seit sie vor gut zwei Jahren hier angelegt wurden. Queller, Andelgras, Strand-Sode gedeihen gut. Alles Arten, die sich besonders schnell ausbreiten können. Die Samen mancher von ihnen können schwimmen, andere werden vom Wind weitergetragen. Sie können sich jedoch gegenüber anderen Arten der etablierten Inseln nicht durchsetzen. Vor allem, weil sie nur einjährig und sehr klein sind. So können sie schnell von höheren, mehrjährigen Pflanzen beschattet und verdrängt werden. Auf den Salzwiesen von Spiekeroog und Co. findet man sie daher kaum. „Selbst hier auf unseren künstlichen Inseln finden also die Arten ein Refugium, die ansonsten schnell verdrängt werden.
Interessant wird nun, wie lange es dauert, bis sich hier die typische Salzwiesenkonstellation angesiedelt hat“, so Kleyer. Später würden die Vögel folgen, Wattvögel, Enten und Möwen würden vermutlich zum Rasten vorbeikommen, vielleicht würde es auch Brutvögel geben. Mehr und mehr würde sich hier das Leben ansiedeln. Doch bis es tatsächlich kommt, werden die Metallboxen wieder abgebaut sein. Anders auf dem neu entstandenen Eiland nahe der Westküste Schleswig-Holsteins: Hier wird irgendwann das, was einst als Sandbank aus dem Meer stieg, eine Insel sein, so wie wir sie von Spiekeroog kennen.
Zwerge und Riesen
Zu Beginn sind ankommende Populationen, egal ob in der Nordsee oder im Pazifik, jedoch starken Schwankungen unterworfen. Jede neu eintreffende Art erhöht die Konkurrenz für die bereits heimisch gewordenen, denn Platz und Nahrungsquellen sind auf Inseln meist noch mehr begrenzt als auf dem Festland. Eine Anpassungsmöglichkeit ist die sogenannte Inselverzwergung. So sind der Sumatra-Tiger und seine bereits ausgestorbenen Artgenossen auf Bali und Java mit höchstens 140 Kilogramm im Vergleich zum mehr als doppelt so schweren Sibirischen Tiger oder Königstiger auf dem Festland wahre Leichtgewichte. Auf Sumatras Nachbarinsel Borneo lebt außerdem ein Zwergelefant, der mit gerade einmal 2,5 Metern Schulterhöhe eindeutig im Schatten seiner viel größeren Festlandsverwandtschaft mit bis zu 3,5 Metern Schulterhöhe steht.
Es gibt aber auch das umgekehrte Phänomen, den Gigantismus. Ihm kann man auf Komodo begegnen. Die dortigen Warane erinnern an Dinosaurier und werden auch Drachen genannt, und das völlig zu Recht: So wie Drachen im Märchen sehen die Komodowarane aus, mit schuppiger Haut und flachem Kopf, mit Schlangenzunge und kräftigem Körper. Die Reptilien werden bis zu drei Meter lang und mehr als 70 Kilogramm schwer. Mit den Waranen auf Komodo kann keine andere Echsenart der Welt mithalten. Sie sind die letzten Überlebenden einer ganzen Gruppe großer Warane, die bis vor rund 700 000 Jahren die indonesisch-australischen Inseln besiedelten. Ähnlich bei den Riesenschildkröten auf den Galapagosinseln. Keine andere Schildkröte wird so groß wie ihre Verwandten auf den Inseln 1000 Kilometer westlich der Küste Ecuadors. Auch sie sind die Überreste einer bis vor 60 Millionen Jahren einst weit über die Erde verbreiteten Tiergruppe.
Säugetiere können ebenfalls zu Riesen heranwachsen, wie das Beispiel von Mäusen auf der Gough Insel mitten im Südatlantik zeigt. Die Nager kamen im 19. Jahrhundert mit Seefahrern auf das karge Eiland und mussten sich ungewohnte Nahrungsquellen erschließen. Einige von ihnen verlegten sich auf das Fressen von Vogelküken, die wehrlos in ihren Nestern hockten. Die unübliche Diät führte bis heute dazu, dass die Mäuse der Gough Insel deutlich größer ausfallen und mehr als doppelt so viel wiegen wie gewöhnliche Hausmäuse – wohl weil größere Tiere ihre Beute besser überwältigen können.
Neben veränderten Ernährungsgewohnheiten lösen oft fehlende Fressfeinde, die den evolutionären Vorteil eines kleinen, besser versteckbaren Körpers überflüssig machen, solche Wachstumsschübe über Generationen hinweg aus. Die Tiere können es sich also einfach herausnehmen, groß zu sein. Kleinwüchsig werden Inselbewohner vermutlich vor allem wegen des knapperen Nahrungsangebots. Kleinere Individuen, die mit weniger Nahrung und Platz auskommen, haben hier schlicht einen Überlebensvorteil.
Auch der Mensch wurde zum Spielball
Womöglich wurde auch der Mensch in seiner Vorgeschichte zum Spielball dieses Mechanismus: Im Jahr 2003 entdeckten Forscher auf der indonesischen Insel Flores in einer Höhle ein rund 60 000 Jahre altes menschliches Skelett, das mit einer Höhe von etwa einem Meter nicht mal an das von einem Schimpansen heranreicht. Trotzdem ähnelten der Schädel und weitere Eigenschaften eher einem Frühmenschen oder vielleicht auch einem Menschenkind. Die Weisheitszähne wiesen jedoch eindeutig auf einen Erwachsenen hin.
Mark Stoneking erinnert sich noch gut an die hitzigen Diskussionen, die damals in den wissenschaftlichen Kreisen rund um den Zwergmenschen ausgefochten wurden. Der Evolutionsgenetiker arbeitet am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt er sich mit der Evolution des Menschen. „Zunächst glaubten viele Forscher, dass es sich um einen modernen Menschen handeln müsse, der schlichtweg durch eine Krankheit so klein geblieben war.“ Man habe nicht glauben wollen, dass sich auf einer einzelnen Insel eine neue Menschenart entwickelt hatte. Spätere Funde zeigten jedoch, dass diese, später als Flores-Menschen getauften Hominiden, nicht zu Homo sapiens gehörten. Sie bildeten tatsächlich eine neue Art, die von Natur aus sehr klein war.
Warum, das bleibt bislang ein Rätsel. „Möglicherweise war es wie bei anderen Tierarten auch. Die Ressourcen waren knapp, Feinde gab es kaum“, so Stoneking. „Der Trend zum Kleinwuchs stellte sich also als Überlebensvorteil heraus.“ Unklar ist auch, warum sie trotzdem ausstarben. Den „Hobbit-Menschen“ könnte die Nahrung knapp geworden sein, klimatische Veränderungen könnten ihm zusätzlich zu schaffen gemacht haben. Es könnte aber auch eine Epidemie gewesen sein. Denn eines haben die Menschengruppen, die Inseln neu besiedelt haben, gemeinsam: Sie sind aus einer kleinen Gruppe von Pionieren hervorgegangen und sind sich somit genetisch sehr ähnlich. Das macht sie wiederum anfällig für Krankheiten.
Auch heute lebt auf Flores noch eine Menschengruppe, die im weltweiten Vergleich sehr klein ist. Die Rampasasa sind durchschnittlich lediglich 1,50 Meter groß. Dass sie direkte Nachkommen der Flores-Menschen sind, ist jedoch unwahrscheinlich. Wie alle derzeit noch lebenden Menschen gehören sie zu Homo sapiens, dessen Stammbaum in allen Details ja noch nicht endgültig geklärt ist. Der Flores-Mensch zumindest hatte sich wohl aus dem Homo erectus entwickelt.
Anfällig gegenüber Eindringlingen
Neben ihrem Engwicklungspotenzial für Exoten kennzeichnet Inseln eine weitere Eigenschaft: Sie sind anfällig gegenüber eingeschleppten Arten. In kürzester Zeit können Neuankömmlinge die sensible Flora und Fauna grundlegend umkrempeln und viele der nur hier vorkommenden Arten aussterben lassen. Tatsächlich sind laut einer aktuellen Studie Meeresinseln die Lebensräume, die am stärksten von Eindringlingen gefährdet sind. Der Grund: Häufig fehlen hier schlicht die Konkurrenten und die Räuber. Dadurch haben viele der Tiere keine Mechanismen entwickeln müssen, um sich durchzusetzen oder zu schützen, indem sie sich etwa tarnen oder auf Bäumen leben. Viele haben den Fluchtinstinkt verloren.
Die Studie sieht dabei besonders Hawaii und die Nordinsel Neuseelands in Gefahr. „Beide sind geografisch so isoliert und haben einzigartige Floren und Faunen, die auf die vielfältigsten eingeschleppten Arten gar nicht vorbereitet waren“, erklärt Marten Winter, Biologe am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig und einer der Forscher hinter der Studie. „Gleichzeitig sind sie im Verhältnis zu anderen Inseln besonders dicht bevölkert und hochentwickelt.“ Das bedeute ein reges Kommen und Gehen an Waren und Menschen – und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, fremde Arten einzuschleppen, die etwa im Brackwasser von Schiffen schwimmen oder an Schuhsohlen kleben.
Neuseeland war beispielsweise über Jahrtausende ein Eiland der flugunfähigen Vögel, etwa des symbolträchtigen Kiwi. Das änderte sich jedoch schlagartig mit der Ankunft der Europäer gegen Ende des 18. Jahrhunderts: Die britischen Siedler versuchten, am anderen Ende der Welt ein zweites England zu kreieren. Katze, Hund, Marder und Hermelin gehörten für sie dazu. Die heimischen Vögel traf diese Einwanderungswelle besonders hart: Viele von ihnen waren und sind leichte Beute für die Neuankömmlinge, denn sie sind flugunfähig, brüten ihre Eier auf dem Boden aus und haben auch keinerlei Schutzvorkehrungen gegen Räuber entwickelt. Sie waren schlichtweg nicht notwendig gewesen.
McDonalds ist überall
Mehr als 40 Prozent der heimischen Landvogelarten Neuseelands sind seither ausgestorben, zahlreiche weitere stark gefährdet, darunter der Kiwi. Trotz weltweiter Anstrengungen, von Ausrottung bis zur Reinigung von Brackwasser großer Schiffstanker, gibt sich Biologe Winter skeptisch. Er glaubt, dass sich die weltweite Invasion einiger besonders erfolgreicher Spezies zwar verlangsamen lässt. Langfristig aufhalten kann man sie jedoch nicht. Und damit auch nicht eine Entwicklung, die bereits in vollem Gange ist: Die Angleichung aller Tier- und Pflanzenwelten weltweit, selbst bisher einzigartiger Inselparadiese. Das Exotische, der Zwerg, der Riese würden mehr und mehr verdrängt. Er und viele seiner Kollegen sprechen gar von der McDonaldisierung der Lebensräume.
Solange es Naturlaboratorien wie das der Süßwasserschnecken auf Sulawesi jedoch noch gäbe, müsse man die Zeit nutzen, um Darwins Gedanken zu Ende zu führen, so Evolutionsbiologe Glaubrecht. „Das Erstaunliche ist ja, dass seine Theorie nach 150 Jahren immer noch Bestand hat. Aber es gibt ein paar Lücken in der Beweisführung. Er konnte nicht wirklich die Frage beantworten, warum es so viele verschiedene Tierarten gibt.“ Die Erkenntnisse über die Rolle der Ökologie haben da einiges geklärt. Manchmal würde er sich wünschen, dass Darwin mit dabei sein könnte. Dann könnte er sehen, was heute noch mithilfe seiner Theorie alles erforscht wird.