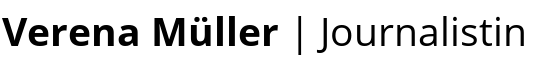Für immer Ferien
Es klingt wie der Traum vieler Kinder: nie mehr Schule. Und nur das lernen, was man will. In Deutschland formiert sich eine Bewegung, die sich genau dafür einsetzt. Kann das funktionieren?
(Gehirn & Geist, Juni 2020)

Strukturiert, fleißig, engagiert. Friederike* ist 23, studiert in einer Kleinstadt im Osten Sachsen-Anhalts und gilt als Vorzeigestudentin. Sie ist eine der wenigen, die jede Vorlesung besucht. Gute Noten sind ihr wichtig, sagt sie. Sie wolle zeigen, dass sie klug ist. Wahrscheinlich war sie schon als Schülerin strebsam, so wie sie auftritt, hier in einem Café im Leipziger Süden.
Von wegen. Friederike brach die Schule ab. Sie wurde zur „Freilernerin“. Zu einer, die lernte, wann, wo und worauf sie Lust hatte. Auch ihr Abitur bestand sie später in Eigenregie, ohne täglich in einem Klassenraum zu sitzen. „Schule ist Freiheitsentzug“, erklärt sie. Anders als beim Homeschooling, bei dem die Kinder zu Hause nach mehr oder weniger klaren Vorgaben unterrichtet werden, lehnen Freilerner jeden Lehrplan ab. Sie beschäftigen sich allein mit dem, was sie wirklich interessiert, und lassen sich ganz von ihrer Neugier treiben. Für Friederike war es vor allem der starre Rahmen der Schule, den sie als belastend empfand. Der Wechsel zwischen Mathe, Deutsch, Geschichte im 45-Minuten-Takt, die Orientierung an den Defiziten der Schüler, die Fixierung auf Prüfungen. Und überhaupt, wer lege denn fest, was man wissen müsse und was nicht? Jeder sollte die Freiheit haben, selbst über die eigene Bildung zu entscheiden, findet sie.
Laut der Kultusministerkonferenz gibt es in Deutschland derzeit etwa 500 bis 1000 Kinder, die noch nie oder nur sporadisch eine Schule besucht haben. Trotz absoluter Schulpflicht, nach der jedes Kind in eine staatlich geprüfte Institution gehen muss, um zu lernen. Tut es das nicht, drohen den Eltern Strafen, von Bußgeldern bis zum Entzug des Sorgerechts. Dennoch wächst nach eigenen Angaben die „Freilerner“-Gemeinde auch in Deutschland seit Jahren und organisiert sich immer professioneller. Eigene Anwälte beraten sie in Rechtsfragen, ein Verein leistet im Ernstfall finanzielle Unterstützung. Ihre Anhänger versammeln sich zu Stammtischen, einmal im Jahr gibt es ein Festival. Leipzig gilt dabei bundesweit als eines der Zentren der Bewegung.
Fünf Gehminuten entfernt, ein flaches Haus im Stadtteil Connewitz, mit seinem alternativen Flair, verrauchten Kneipen, den Graffitis und Plakaten an den Wänden. Ein kleines Tor führt über den Garten zur Haustür. Hier lebt Friederike mit ihren Eltern und ihren drei Halbbrüdern, 16, 12 und 4 Jahre alt. Freundlich begrüßt mich die Mutter, Janette Ulick, an diesem Donnerstagmittag im Februar. Vater Bernd kommt gerade vom Billardspielen mit dem zwölfjährigen Mateo zurück, der seit der zweiten Klasse nicht mehr zur Schule geht. „Für ihn sind jeden Tag Ferien“, sagt seine Mutter lächelnd. Sie und ihr Mann arbeiten bei einem öffentlich-rechtlichen Regionalsender, für den sie die Sendungen mit Untertiteln versehen. Die Zeit dafür können sie sich frei einteilen.
„Irgendwann ging es einfach nicht mehr“, beginnt Janette langsam zu erzählen, hier im gelb gestrichenen Wohnzimmer, zwischen Traumfängern, Familienfotos und Kinderzeichnungen. Vom ersten Tag an habe Mateo nicht in die Schule gewollt, verweigerte sich den Aufgaben. Dazu die vielen Fragen, die er im Unterricht nicht loswerden konnte, und die traurigen Smileys, bei denen er jedes Mal dachte, etwas falsch gemacht zu haben. Krank habe ihn das gemacht. Da halfen auch die Gespräche mit Lehrern und dem Direktor nichts, alternative Schulen hatten keinen Platz für ihn. „Wir hörten vom Freilernen und atmeten auf.“ Erst entschied sich Friederike dafür, dann folgte Mateo, später der ältere Bruder, der durch die Schule „immer lethargischer« geworden sei. „Wenn wir uns als Eltern sowieso umstellen und viel zu Hause sein mussten, konnten das auch gleich alle Kinder machen.“ Plötzlich ersetzte Youtube die Lehrer, die Waldgruppe die Klassenkameraden. „Wir waren überrascht, wie viele gute Videos es im Internet gibt, über Mathe oder wie man den Zauberwürfel löst“, sagt Janette.
Freiheit – eine Herausforderung
„Kannste mir einen Kaffee machen? Heiß!“, ruft Mateo seiner Mutter in der Küche zu, als er aus seinem Zimmer schlurft. Kurz darauf steht die Tasse für ihn auf dem Tisch. Der Junge wirkt unsicher und bestimmt zugleich, wie er da vor einem sitzt. Ob ihm manchmal langweilig sei hier zu Hause? Mateo schüttelt den Kopf. Seine Nachhilfelehrerin gebe ihm genügend Hausaufgaben. Seit einem Jahr kommt eine ehemalige Sonderpädagogin zweimal in der Woche zu ihnen nach Hause, übt mit dem Jungen Mathe, Deutsch und Sachkunde. Das vollkommen freie Lernen sei für ihn doch nicht das Richtige gewesen, erzählt seine Mutter später. „Ansonsten habe ich noch meine Konsole«, sagt der Junge, als er über seine anderen Beschäftigungen nachdenkt. „Und manchmal gehe ich auch raus.“ Allein habe er allerdings nicht so oft Lust dazu. Freunde? Eigentlich keine, seitdem er nicht mehr zur Schule gehe. Nur einen, den lernte er vor zwei Jahren online beim Spielen kennen. Vor einem Jahr hätten sie sich getroffen, aber nur einmal. Die Fahrt zu ihm dauert fast drei Stunden.
Lange sei ihr Modell gut gegangen, erzählt Janette, auch wenn das „Entschulen“ eine Weile gedauert habe, dieses Loslassen von alten Denk- und Zeitstrukturen. Doch irgendwann hielten die Eltern dem Druck von staatlicher Seite nicht mehr stand, emotional und finanziell. Die Bußgelder häuften sich, sie führten Gerichtsprozesse, es drohte ein Zwangsgeld im fünfstelligen Bereich. Das Jugendamt stand vor der Tür, wegen Kindeswohlgefährdung. Nur mit psychologischen Gutachten gebe es in Deutschland eine Chance, sich der Schulpflicht zu entziehen, erklärt sie. Mateo wurde eine autistische Störung bescheinigt. Dennoch blieb die Angst, die Kinder zu verlieren. Sie entschieden, es noch einmal im „System“ zu versuchen. Der älteste Bruder geht seit zwei Jahren wieder zur Schule, Mateo wird es ab Sommer probieren.
Wie sich Kinder entwickeln, die ihr Leben lang selbstbestimmt lernen durften, ist bislang kaum untersucht. Viele Anhänger des Freilernens verweisen auf eine 2015 publizierte US-amerikanische Studie von Peter Gray und Gina Riley zu den Folgen von „Unschooling“, so der internationale Begriff. Laut der Befragung sind die meisten Freilerner heute finanziell unabhängig und haben keine Nachteile aus ihrem unkonventionellen Lebenslauf erfahren. Der Artikel erschien in der Fachzeitschrift „Other Education: The Journal of Educational Alternatives“. Gray setzt sich als Präsident der Stiftung „Allianz für selbstbestimmte Bildung“ seit Jahren für alternative Lernformen ein.
„Die Daten sind nicht repräsentativ und ihre Interpretation oft interessengesteuert“, erklärt Thomas Spiegler von der Theologischen Hochschule Friedensau in der Nähe von Magdeburg. Auf die Freilerner-Bewegung stieß der Soziologe, als er sich mit religiösem Fundamentalismus beschäftigte. „Manche Eltern sehen es als ihren ‚gottgegebenen Auftrag‘, ihre Kinder zu unterrichten.“ Doch die meisten verfolgten hier zu Lande eher das Ziel des selbstbestimmten Lernens, glaubten an eine angeborene Begeisterung, die durch Schule und Erziehung kaputt gemacht werde. Dabei fassen sie oft jede Aktivität des Kindes als Lernprozess auf, sagt Spiegler. Das könne gut gehen: Kinder, die nie oder nur kurz eine Schule besucht haben, seien nicht zwangsläufig schlechter im Lesen oder Rechnen. Bei weitergehenden Fertigkeiten hänge es dann sehr vom Einzelfall ab. Ein wichtiger Faktor sei, so vermutet er, ähnlich wie in der Schule der Bildungshintergrund der Eltern und deren Engagement. „Die Anhänger des Unschoolings definieren Erfolg aber ohnehin anders“, erklärt Spiegler: Ihre Ziele sind eher Freude und Interesse am Lernen, Selbstbestimmung oder praktisches Wissen.
Misstrauen gegenüber „dem System“
Das System. Wie ein roter Faden zieht sich der Begriff durch die Freilerner-Szene. Auch an diesem Abend im Februar, in einem Kulturzentrum im Leipziger Süden, drei Stufen hinab ins Untergeschoss. Hier treffen sich bei wenig Licht und vielen Keksen einmal im Monat ihre Anhänger, um zu überlegen, wie sie sich „aus dem System rausretten“ können. Heute sind vier von ihnen gekommen. Zwei Mütter, ein Vater und eine junge Frau ohne Kinder, die das Konzept wegen ihrer eigenen schweren Schulzeit unterstützen will, wie sie sagt. Die Stimmung ist konspirativ, Aktenordner wandern auf den Tisch, Paragrafennamen fallen. Dazwischen Witze über Staat, Politik und die „irre“ Impfpflicht. Nachrichten im Fernsehen schauten sie schon lange nicht mehr, auch wählen würden sie nicht gehen.
Eine der Lautesten am Tisch ist Kerstin, die Organisatorin der Gruppe, eine Frau mit langen grauen Haaren und bestimmtem Blick. Ihre beiden inzwischen erwachsenen Kinder besuchten nie eine Schule, die Tochter sei heute zufrieden mit ihrem Job in einem Bekleidungsgeschäft. „Die Frage ist doch weniger, warum unsere Kinder nicht zur Schule gehen“, erklärt sie. Eher müsse man sich fragen, warum sie überhaupt dahin sollten. An diesen „unnatürlichen“ Ort, an dem sie lediglich anhand ihres Alters und Wohnorts zusammengewürfelt seien und vorgeschrieben bekämen, wann sie aufs Klo dürfen, wo sie sitzen. Und das jeden Tag, selbst, wenn man mal was vorhat oder das Kind spät ins Bett gegangen ist. Vollkommen fremdgesteuert sei man da, die eigenen Bedürfnisse würden ständig übergangen. Ihre Abneigung gegenüber der Institution ist in jedem ihrer Worte spürbar. „Wir sind nur konsequent in dem, wonach sich andere sehnen“, sagt sie mit Nachdruck. Eine andere Mutter aus der Runde erzählt von jenem entscheidenden Morgen, an dem ihr damals elfjähriger Sohn sagte, er sei „lieber tot, als wieder in die Schule zu müssen“. Der Vater in der Runde schaltet sich ein: „Das System macht die Kinder so kaputt, dass sie später erst mühsam herausfinden müssen, was sie wirklich wollen.“ Aus seiner Sicht entstehen genau dadurch die vielen psychisch Kranken. Im Gespräch weist Kerstin die Neulinge immer wieder darauf hin, wenn sie Dinge ihrer Meinung nach falsch benennen, etwa von „Wissen“ statt von „Bildung“ sprechen. Man müsse sich vom alten Denken verabschieden. In diesen Momenten haftet der Bewegung beinahe etwas Sektenhaftes an.
Andererseits: Mit seinem Schulzwang steht Deutschland europaweit ziemlich allein da. Von Schweden abgesehen, herrscht in den meisten anderen Ländern lediglich Bildungspflicht, darunter in unserem Nachbarland Österreich. Ob die Kinder zur Schule gehen oder sich die geforderten Standards anderswo aneignen, steht den Eltern frei. Es wird lediglich kontrolliert, ob der Sprössling ein ausreichendes Wissensniveau erreicht.
Vielen Freilernern würde auch das zu weit gehen. Darunter den Leitners. Die Eltern lehnen jeden Zwang in der Erziehung ihrer drei Kinder ab. Nur der Älteste – jetzt zwölf Jahre alt – habe es drei Jahre an einer regulären Schule versucht. Die anderen beiden, sechs und neun Jahre, waren noch nie in der Schule. Die Eltern stocken, als sie von ihnen erzählen. Sie wollen sie schützen, wollen nicht, dass Außenstehende sie mit Fragen löchern. Wie normale Kinder sollen sie sich fühlen. Bei
dem zwölfjährigen Jaro sei es vor allem die Sache mit dem Lesen gewesen, die ihm die Lust an der Schule genommen habe. Von klein auf habe er Bücher geliebt. Mit der Schule sei plötzlich seine Freude daran verschwunden. Eines Tages kam er nach Hause, habe sich als der Schlechteste der Klasse gefühlt. Zudem der Druck mit den täglichen Hausaufgaben, den sie nicht mittragen wollten. Und schließlich die Sache mit den Schuhen. Bis dahin sei er immer barfuß gelaufen, auf
einmal durfte er das nicht mehr, erzählt Marie Leitner, gelernte Sozialarbeiterin: „Er konnte einfach nicht so sein, wie er wollte.“
Ist der Vorwurf berechtigt, dass unser Bildungssystem den Kindern das Lernen „austreibt“, statt sie zu ermutigen? „Das Interesse an vielen schulischen Inhalten nimmt im Lauf der Schulzeit tatsächlich deutlich ab“, sagt Jan-Henning Ehm vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung
und Bildungsinformation in Frankfurt. Er hat sich lange damit beschäftigt, was Kinder in der
Schule motiviert. Auch er ist von einem angeborenen Interesse an der Welt und am Lernen überzeugt. Lehrer müssten schaffen, dieses zu nutzen, statt es kaputt zu machen, sagt er: „Dann kann aus Neugier langfristiges Interesse werden.“ Die Frage ist nur wie.
Eine große Rolle spiele, welches Bild die Kinder in der Schulzeit von sich selbst und ihren Fähigkeiten entwickeln, ihr 2Selbstkonzept“, erklärt Ehm. Vor der Einschulung würden sich viele Kinder überschätzen – sie glauben, alles zu können, wenn sie sich nur genügend anstrengen. „Wer gut ist in etwas, der ist dazu meist auch motiviert. Doch merkt ein Schüler, dass er in einem bestimmten Bereich weniger erfolgreich ist als andere, kann er schnell das Interesse daran verlieren.“ Wie Jaro leiden in jeder Klasse Kinder daran, angeblich zu den Schlechtesten zu gehören. Die Notengebung befördert das noch. Miese Zensuren wirkten oft extrem demotivierend, ihr negativer Effekt ist gravierender als der positive Einfluss guter Noten. Zwar seien Rückmeldungen generell wichtig. Sie sollten aber laut Ehm eher den persönlichen Lernfortschritt betonen und dem Schüler zeigen, dass er heute etwas besser kann als noch vor einigen Wochen.
Zunächst waren Forscher davon ausgegangen, dass sich das Bild von der eigenen Leistung bereits in der Grundschule verfestigt. Neuere Studien jedoch zeigen, dass diese Einschätzung noch länger schwankt und immer wieder davon abhängt, mit wem man sich vergleicht. In der weiterführenden Schule kann daher das Selbstkonzept laut Ehm ein weiteres Mal einmal kräftig durchgeschüttelt werden. Pädagogen sprechen vom „Fischteich-Effekt“: Schüler in einer leistungsschwächeren Klasse sind stärker motiviert, ihre Erfolge fallen dort deutlicher auf, sie fühlen sich als großer oder wenigstens mittlerer Fisch unter vielen kleinen Fischen. Wechseln sie dagegen in ein leistungsstarkes Umfeld, kann ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten leiden.
Sinkende Motivation
Oft hadern Kinder nach überstandener Grundschulzeit besonders stark mit dem schulischen Lernen. „Aus Befragungen von Schülern wissen wir, dass bei Zehn- bis Zwölfjährigen die Motivation nochmals sinkt“, sagt Rainer Watermann von der Freien Universität Berlin. Lange Zeit dachte man, das sei eben die Pubertät, so der Professor für Erziehungswissenschaft. Inzwischen weiß
man: Die Unlust bezieht sich meist nicht auf alle Fächer. Vielmehr schärfen sich die Interessen, ob in Mathe, Deutsch oder Musik – in einzelnen Bereichen behielten die Schüler ihre Freude daran. Hinzu kommt aber der Drang, von den Erwachsenen unabhängiger zu werden, die Gleichaltrigen werden wichtiger. Diesen Wünschen werde die Schule oft nicht gerecht, erklärt Watermann: „Die Schüler brauchen jetzt das Gefühl, selbstbestimmt lernen zu können, Wahlmöglichkeiten zu haben, in soziale Gemeinschaften eingebunden zu sein.“ Projektarbeiten etwa würden diese Bedürfnisse besser erfüllen als Frontalunterricht.
Zwar sind Freilerner-Kinder der Leistungskonkurrenz zunächst weniger ausgesetzt. Ganz entziehen könnten sie sich ihr jedoch nicht, so Ehm. Bereits 1954 prägte der Sozialpsychologe Leon Festinger an der Stanford University die „Theorie des sozialen Vergleichs“. Demnach liegt es in der Natur des Menschen, sich mit anderen zu vergleichen, um ein Selbstbild aufzubauen: Wer rennt schneller als ich, wie sehen die anderen aus, wer darf in der Spielgruppe am meisten bestimmen? Solche Fragen kommen Kindern ganz automatisch.
Die Leitners versuchten es trotzdem. Die fünfköpfige Familie zog nach Portugal, wo viele Gleichgesinnte aus Deutschland leben. Rechnen beim Kuchenbacken, Ökologie beim Toben im Wald. „Es schien uns wie das Paradies, keine Angst, kein Druck“, sagt Marie Leitner rückblickend. Ein Jahr später kehrten sie in die Heimat zurück. Gescheitert sei es vor allem am Geld. Ihr Mann begann, wieder in seinem alten Beruf als technischer Zeichner zu arbeiten. Und erneut wartete die Schulpflicht auf sie.
Wie ein typischer Tag heute bei ihnen aussieht? Einen festen Ablauf gibt es nicht, sagt Marie. Der Versuch, eine feste Lernzeit einzuführen, war gescheitert. „Ich als Lehrerin, das funktionierte einfach nicht.“ Irgendwann ließen sie die Sache laufen. „Die Kinder gehen spazieren, zur Bibliothek, treffen Freunde, beschäftigen sich mit sich selbst, sind im Karate- und Capoeira-Verein
aktiv.“ Die Sechsjährige könne schon jetzt Wörter zusammensetzen, die Ältere habe mit ihren neun Jahren da Probleme. Der Zwölfjährige versinke am liebsten in Rollen- und Computerspielen. Dennoch, betont der Vater, beschäftige sich sein Sohn auch gern mit Pi und Kreisrechnung – aber eben freiwillig. Müssten sie nicht in der Illegalität leben, könnten sich die Kinder noch
mehr entfalten, sind sich beide sicher.
Doch genügt die von den Freilernern beschriebene innere Neugier, um sich selbst anspruchsvollere Dinge beizubringen? „Interesse allein reicht nicht“, widerspricht Watermann. Lernen baue nach einer bestimmten Logik aufeinander auf, bei schwierigeren Aufgaben müsse man auf zuvor erworbene Wissenselemente zurückgreifen. Diesen Prozess zu unterstützen, ist der Job von Pädagogen. Als Kind kann man zudem nicht einschätzen, ob man später beispielsweise einmal binomische Formeln braucht, so Watermann weiter. Auch er hätte Mathe in der Schule lieber abgewählt, heute ist er Professor für empirische Bildungsforschung: „Ohne Statistik geht da nichts.“ Außerdem vermittelt die Schule mehr als Wissen. Die Kinder lernen, in der Klassengemeinschaft klarzukommen, in einer Institution ihre Rolle einzunehmen und sich an vorgegebene Regeln zu halten. Gerade diesen „heimlichen Lehrplan“ sehen allerdings viele Freilerner kritisch. Wer immer nur Anweisungen befolge, lerne zudem nicht, sich selbst zu führen.
Laut Silke Traub vom Institut für Schul- und Unterrichtsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe kann selbstbestimmtes Lernen aber auch in Schulen stattfinden. Dabei gelte es, die Kinder zuerst anzuleiten, bevor man sie „loslasse“: „Man muss erst einmal begreifen,
wie man das eigentlich macht, neues Wissen aufnehmen, einüben, sich merken, es vernetzen.“
Freilernerin Friederike ist sich dagegen sicher, dass sie jungen Erwachsenen mit einer klassischen Schulkarriere einiges voraushat. Vor allem die Struktur, die sie sich selbst geben kann, sagt sie. Noch viel entscheidender sei jedoch, dass sie sich ihre Begeisterungsfähigkeit bewahrt habe. Die wäre ihr, da ist sie sich sicher, in der Schule früher oder später geraubt worden.
(*alle Namen geändert)