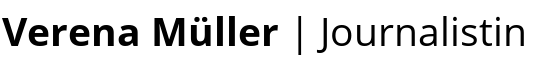Gefährliche Einfalt
Einige Arten entkommen immer wieder nur knapp dem Aussterben. Selbst wenn noch scheinbar viele Exemplare von ihnen existieren, haben sie ein Problem: ihre geringe genetische Vielfalt.
(NATUR, April 2017)

Seit einigen Jahren kann es vorkommen, dass plötzlich Quasimodo am Wegesrand steht. 1000 Kilogramm massiv-kompakter Körper, langes zotteliges Fell, gebogene Hörner, zwei Meter hoch. Was nach den Prärien Kanadas klingt, kann dem Wanderer nun auch wieder im Rothaargebirge, im Südosten Nordrhein-Westfalens, begegnen: ein Wisent, die europäische Version des Bisons und das größte und schwerste Landsäugetier auf unserem Kontinent. War er noch bis Anfang des letzten Jahrhunderts in den Wäldern Europas weit verbreitet, sorgte intensive Jagd dafür, dass er in den 20er Jahren nahezu ausgerottet war. Lediglich 56 Tiere blieben übrig.
Einige Jahrzehnte und viele engagierte Artenschutzinitiativen später gibt es heute wieder an die 4500 Tiere in Europa, aktuell auch 22 in Deutschland. Darunter ist Quasimodo, einer der ersten wieder in freier Natur geborenen Wisente. Seine Geschichte scheint damit auf den ersten Blick ein echter Erfolg zu sein. Dabei ist seine Zukunft keineswegs in trockenen Tüchern. Immer wieder wird er von Krankheiten heimgesucht, die große Teile der Herden auslöschen. Aktuell ist es eine Geschlechtskrankheit, die unter den Tieren grassiert.
Ähnlich ergeht es auch dem Tasmanischen Beutelteufel. Seit mehr als 20 Jahren dezimiert ein ansteckender Tumor die Population. Einige Forscher halten es für wahrscheinlich, dass die Spezies deshalb in den nächsten 20 bis 30 Jahren ausgestorben sein könnte. Die Ursache für diese Schicksale ist eine geringe genetische Vielfalt.
So geht zum Beispiel jeder der heute lebenden Wisente auf 12 Tiere zurück, die sich damals aus den 56 Überlebenden fortpflanzten. Damit sind sich ihre Nachkommen genetisch sehr ähnlich – zu ähnlich. Denn die genetische Vielfalt ist die natürliche Rückversicherung der Natur. Kein Vogel, kein Käfer, kein Schwein gleicht dem anderen, selbst wenn sie der gleichen Art angehören.
Fundus an Genen
Jedes Lebewesen, das sich geschlechtlich fortpflanzt, trägt bis auf seltene Ausnahmen zwei Sätze Chromosomen in sich. Einen vom Vater, einen von der Mutter. Korrespondierende Stellen unterscheiden sich gewöhnlich durch winzige Abweichungen, sodass Fehler und Schwächen in der einen Variante durch die des anderen Elternteils ausgeglichen werden können. Jede Art besitzt damit einen unglaublichen Fundus genetischer Informationen, aus dem jedes Einzelwesen in etwas anderer Ausführung aufgebaut ist.
Diese Variation ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass die Nachkommen über neue genetische Kombinationen und damit über Eigenschaften verfügen, durch die sie sich möglicherweise besser an neue Umweltbedingungen anpassen können. Kann der eine etwas besser mit Wassermangel umgehen, macht dem anderen vielleicht ein bestimmter Nährstoffmangel weniger zu schaffen. Oder wiederum ein anderer ist immun gegen eine bestimmte Krankheit.
Wenn nur die Verwandten zur Wahl stehen
Wenn jedoch Geschwister, Vettern und Cousinen gemeinsamen Nachwuchs bekommen, so findet man an vielen Stellen zwei identische Varianten der einzelnen Gene. Tiere und Pflanzen haben daher eine Reihe von Strategien entwickelt, um engen Verwandten bei der Partnerwahl aus dem Weg zu gehen und Inzucht zu vermeiden. Wenn jedoch nur wenige Exemplare einer Art übrig geblieben sind und diese zudem in einer zersiedelten Landschaft in isolierten Gruppen leben, bleiben nur noch die Verwandten als Geschlechtspartner.
Forscher sprechen dann von einem genetischen Flaschenhals, also einem starken Engpass. Selbst wenn es einer Art gelingt, diesen zu überwinden, bleiben die Spuren über lange Zeiträume erhalten – und lassen die Art lange auf einem schmalen Grat zwischen Aussterben und Überleben wandeln.
Doch von welcher Populationsgröße an sind seltene Arten wie etwa der Wisent genetisch entsprechend gewappnet? Seit Jahrzehnten streiten Biologen darüber. Um bedrohte Spezies zu retten, setzten Tierschützer bisher oft einige wenige Paare aus in der Hoffnung, dass diese eine neue Population gründen. Da man aber bis heute für die meisten Arten nicht weiß, wie viele Tiere es zur erfolgreichen Fortpflanzung braucht, ist das Ergebnis solcher Bemühungen jeweils sehr unsicher.
Für Naturschutzkonzepte ist diese Frage jedoch von großer Bedeutung, etwa wenn es um die Mindestgröße von Schutzgebieten, Jagdquoten oder um die Entscheidung geht, Unterarten aus verschiedenen Gebieten gezielt zu kreuzen.
Wann ist die Gruppe über den Berg?
Eine Antwort zu finden, erweist sich als schwierig. Das kann auch Annegret Grimm-Seyfarth, Biologin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig bestätigen. „Zunächst muss klar sein, von welcher Population man überhaupt spricht“, so Grimm-Seyfarth. „Meint man alle Tiere der gleichen Spezies, die an einem Ort leben, oder nur die, die sich miteinander fortpflanzen können?“
Auf unser Beispiel übertragen: Alle 22 Wisente, die aktuell im Rothaargebirge leben, oder lediglich das eine Männchen, das bisher mit verschiedenen Weibchen für Nachwuchs in der Gruppe gesorgt hat? Sofort schrumpft die für den Fortbestand sorgende Lebensgemeinschaft rechnerisch von 22 auf zwei Stück. „Lange galt die 50/500-Daumenregel“, so die Populationsexpertin. Demnach dürfe es kurzfristig nicht weniger als 50 fortpflanzungsfähige Tiere in einer Gemeinschaft geben, um statistisch Inzucht zu vermeiden. Langfristig müsse man sich bei mindestens 500 Tieren einpegeln, um eine ausreichend hohe genetische Variabilität zu erhalten. „Heute geht man aber von mindestens 5000 Stück aus, weil man weiß, dass sich nur wenige, häufig nur zehn Prozent, aus der Gemeinschaft tatsächlich miteinander fortpflanzen können.“ So hat eine Studie an einer Lachszucht beispielsweise ergeben, dass in einer Laichpopulation mit bis zu 10 000 Tieren nur 132 für Nachkommen sorgen können.
Das heißt aber nicht, dass alle Spezies, die unter diese magische 5000er-Grenze fallen, auf längere Sicht dem Tod geweiht sind. „Man muss auf jede Art einzeln schauen“, sagt Grimm-Seyfarth. Ganz entscheidend sei zum Beispiel das Alter. „Je älter eine Art wird, desto größer muss die Population sein, damit sie stabil bleibt.“ Denn bei langlebigen Arten ist der Abstand von einer Generation zur nächsten größer und es dauert länger, neue Genvarianten zu erzeugen.
Um vorauszusagen, ob eine Population um ihre Zukunft bangen muss, bedienen sich Biologen vor allem Computermodellen. Diese füttern sie mit Daten über die Fruchtbarkeit, das Alter oder die Sterberate. Annegret Grimm-Seyfarth tut dies für den australischen Gecko. Und das, obwohl dieser Kandidat keineswegs um seinen Fortbestand bangen muss. Im Gegenteil: An seinem angestammten Ort, im australischen Outback, gibt es ihn in Hülle und Fülle.
„Diesen Gecko beobachten wir seit beinahe 30 Jahren. Dadurch wissen wir sehr genau, durch welche Faktoren sich eine Lebensgemeinschaft verkleinert oder vergrößert.“ Mittels dieser Daten können Forscher wiederum Modelle entwickeln, die sich auf andere Arten übertragen lassen und mit denen ihre voraussichtliche Entwicklung unter den jeweiligen Umweltbedingungen berechnet werden kann.
Einfalt auch im Stall
Doch nicht nur in freier Wildbahn ist bei einigen Arten die Vielfalt zu einer gefährlichen Einfalt zusammengeschrumpft. Auch im Stall hat sich das Spektrum in den letzten Jahrzehnten drastisch reduziert – und das sogar ganz gezielt. Die moderne Landwirtschaft verwendet heute bewusst nur noch wenige besonders leistungsstarke Nutztierrassen. So verteilen sich beispielsweise 99 Prozent aller in Deutschland gehaltenen Schweine auf nur vier Rassen. Auch bei Rindern sieht es nicht anders aus: 96 Prozent gehören zu lediglich vier Rassen und das, obwohl es in Europa beinahe 100 unterschiedliche Rinderrassen gibt. Nach Schätzungen der FAO, der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, ist etwa ein Drittel der 5500 registrierten Nutztierrassen vom Aussterben bedroht. In Deutschland sind es rund 90.
Einige davon konnten sich auf eine Arche retten. Etwa jene tief im Tal der Mulde gelegen, östlich von Leipzig. Hier hat Elsbeth Pohl-Roux gemeinsam mit ihrem Mann rheinisch-deutschen Kaltblütern, Deutschen Legegänsen, Heid- und Moorschnucken, Sachsenhühnern und anderen alten Nutztierrassen ein Refugium gegeben. Rassen, die in Deutschland stark bedroht sind, weil sich keiner so richtig für sie interessiert. Warum auch?
Ein Huhn aus Intensivhaltung ist nach rund einem Monat schlachtreif oder liefert 300 Eier pro Jahr – je nachdem, ob es auf Fleisch- oder Eierproduktion ausgerichtet ist. Ein Sachsenhuhn braucht fast sechsmal so lange und legt nur ein Achtel so viele Eier. Ebenso die Deutsche Legegans oder die Moorschnucke, die deutlich mehr Zeit benötigen, um Fleisch anzusetzen als ihre hochgezüchteten Artgenossen. Merkmale, die im Massenverkauf ein Makel sind. Und dennoch hat sich der Hof in Klosterbuch dem Schutz dieser Tiere verschrieben.
Nur etwas für Idealisten?
„Ein bisschen verrückt muss man schon sein“, sagt Elsbeth Pohl-Roux, „jedenfalls ein Idealist.“ Denn wer sich diese alten Rassen hält, wird von anderen Züchtern oft belächelt. Geld verdient man damit kaum. „Wir glauben, dass wir den Verlust dieser Rassen nicht einfach hinnehmen können“, erklärt Pohl-Roux ihre Motivation. „Um ihrer selbst willen, aber auch, weil uns dadurch wertvolle Eigenschaften verlorengehen – ohne zu wissen, was wir in Zukunft brauchen.“
Ihre Moorschnucken seien ein gutes Beispiel dafür. Von ihnen gibt es in ganz Deutschland aktuell nur noch rund 140 fortpflanzungsfähige Männchen. „Sie grasen hier auf dem Muldendamm und sorgen so für dessen Stabilität, indem sie ihn festtreten und düngen“, erklärt Pohl-Roux. Dabei sind sie nicht nur wesentlich robuster und widerstandsfähiger als ihre hochgezüchteten Artgenossen, sondern mit ihren festen Klauen auch die perfekten Landschaftspfleger. „Was wir an Tierarztkosten pro Jahr haben, ist wirklich lächerlich im Vergleich zu herkömmlichen Betrieben“, so Pohl-Roux.
Kaffee in Gefahr
Auch für die Pflanzenwelt hat man teilweise erkannt, wie wichtig es ist, nicht nur einzelne Arten, sondern auch die Vielfalt innerhalb der Arten zu bewahren – wenn auch bisher vor allem für kommerziell wichtige Spezies. Coffea arabica beispielsweise. Die schwarze Bohne, von deren Sud jeder Deutsche jährlich rund 150 Liter schlürft, ist nach Erdöl wertmäßig der zweitwichtigste exportierte Rohstoff. Dabei stammen weltweit beinahe alle Arabica-Pflanzen aus den Plantagen von ein paar wenigen Vorfahren ab, die einst von Äthiopien nach Jemen ausgeführt wurden. Dementsprechend ähnlich ist ihr Erbgut, sodass Pilze wie der Kaffeerost oder der Erreger der Kaffeekirschenkrankheit leichtes Spiel haben.
In ihrer ursprünglichen Heimat, den Bergwäldern Äthiopiens, hingegen finden sich immer wieder wilde Varianten, die mit solchen Gegnern besser fertig werden. Deren Erbinformationen könnten für die Zucht von widerstandsfähigeren Sorten enorm wertvoll sein. Und möglicherweise lässt sich mit genetischer Unterstützung aus dem Regenwald auch der Ertrag der Pflanzen verbessern, ihre Toleranz gegen Trockenheit erhöhen oder ein besonders niedriger Koffeingehalt erzielen – alles Eigenschaften, die für Züchter hochinteressant sind.
Doch ehe diese Eigenschaften überhaupt erst richtig erforscht werden konnten, drohten sie auch schon zu verschwinden. Denn von den einst ausgedehnten Bergregenwäldern Äthiopiens waren zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur einzelne Flecken geblieben, und diese Reste drohten weiter zu schrumpfen. Damit wären nicht nur einzigartige Ökosysteme verlorengegangen, sondern auch die genetische Schatzkammer des Kaffees. Gerade noch rechtzeitig konnte die UNESCO eingreifen und erklärte seit 2010 drei Kaffeewälder im Südwesten des Landes zu sogenannten Biosphärenreservaten.
„Selbst Samen in einer Genbank einzulagern, hätte in diesem Fall nicht weitergeholfen“, erklärt Thomas Borsch, Professor für systematische Botanik an der FU Berlin, der sich in seiner Forschung mit der nachhaltigen Nutzung von genetischen Ressourcen beschäftigt. Schließlich liege die Stärke des Wildbestandes ja gerade in seiner Flexibilität. Indem er sich ständig auf neue Herausforderungen in seiner natürlichen Umwelt einstellen muss, entwickelt er immer wieder neue Lösungen. „Das kann eine Kollektion eingefrorener Samen nicht leisten“, so Borsch. Zumal es bis heute nicht gelungen sei, diese so zu konservieren, dass sie später wieder normal keimen.
Ähnlich wie mit dem Kaffee verhält es sich bei vielen anderen Pflanzen, die wir für unsere Ernährung nutzen. Trotz der scheinbaren Vielfalt auf unseren Tellern werden 50 Prozent der weltweit für Menschen benötigten Nahrungsenergie von lediglich drei Pflanzenarten – Mais, Reis und Weizen – und davon wiederum nur von wenigen Hochleistungssorten gedeckt. Ein äußerst riskantes Experiment. Denn obwohl Schädlingsplagen immer wieder zur Geschichte der Landwirtschaft gehörten, können sie heute zu globalen Epidemien werden und damit die Ernährungsgrundlage von Millionen Menschen vernichten.
Mensch einfältiger als andere andere Primaten
Und wie ist es eigentlich um die Vielfalt unserer eigenen Gene bestellt? Statistische Analysen der DNA des modernen Menschen haben bei aller äußeren Vielfältigkeit gezeigt, dass wir uns genetisch unerwartet gering voneinander unterscheiden, insbesondere im Vergleich zu anderen Primaten. Selbst wenn man die Genome zweier Menschen vom jeweils anderen Ende der Welt miteinander vergleicht, so sind sie einander deutlich ähnlicher als zwei Schimpansen, Gorillas oder andere Menschenaffen aus unterschiedlichen Populationen.
„Der Grund dafür ist vermutlich ein dramatischer genetischer Engpass, als Homo sapiens vor rund 100 000 Jahren aus Afrika auswanderte und sich schrittweise über Asien, Europa und den Rest der Welt ausbreitete“, erklärt David Reher vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sowohl die Gruppen der in Afrika Gebliebenen als auch die der Ausgewanderten sanken dadurch auf eine gefährliche Größe, einige verschwanden ganz. Laut Schätzungen existierten weltweit teilweise nur noch 1000 bis 10 000 Exemplare unseres Schlags.
Durch diese Wanderungen ist bis heute die Bevölkerung Afrikas genetisch deutlich vielfältiger als der Rest der Menschheit. Gerade hat eine Studie im Fachmagazin Nature belegt, dass eine traditionelle Ethnie umso ärmer an Genvarianten ist, je weiter sie von Afrika entfernt lebt. „Trotz unserer geringen genetischen Vielfalt müssen wir uns erstmal keine Gedanken um unseren Fortbestand machen“, sagt Reher. „Zumindest was die genetische Ausstattung angeht.“ Denn durch unsere technischen Fortschritte seien wir weniger von den äußeren Umständen abhängig, als es andere Lebewesen sind.
Lebewesen wie der Wisent. Trotz intensivster Anstrengungen ist er noch lange nicht über den Berg. Gelingen soll das nun, indem die Tiere in Europa mehr vermischt werden. In einem aufwendigen Auffrischungsprojekt soll eine Gendatenbank dazu dienen, Inzucht zu vermeiden und stattdessen die optimalen Weibchen-Männchen-Konstellationen zu finden. Dazu schicken alle Einrichtungen, die Wisente halten, Blut- und Gewebeproben an die zentrale Sammelstelle an der Universität Warschau, so dass eine Art Kataster mit den Abstammungsdaten und Blutlinien aller in Gefangenschaft lebender Wisente entsteht – und die am besten zueinander passenden Tiere zusammengestellt werden. Die Vielfalt aus dem Reagenzglas soll’s nun richten.