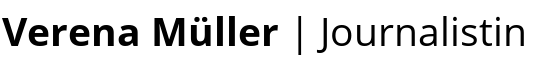Nach dem Feuer
Nicht nur weltweit, auch in Deutschland wächst die Zahl der Brände. Manche Experten sprechen bereits von einem neuen Zeitalter – und suchen nun nach Konzepten für die verbrannte Natur.
(u. a. Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Mai 2020)

Dietrich Henke kann sich noch gut erinnern, wie alles ganz harmlos begann. Wie die Flammen nur am Boden loderten. Wie sie dann auf die jungen Bäume mit ihrem hohen Nadelanteil übergriffen und schließlich zur Feuerwalze wurden. Wie die Feuerwehr nicht mehr in den Wald durfte, Wie schließlich Hubschrauber der Bundeswehr zu Hilfe kamen, drei Dörfer evakuiert werden mussten. Henke ist Stadtförster in Treuenbrietzen, einer Kleinstadt im Südwesten Brandenburgs. Den größten Waldbrand des Landes der letzten 30 Jahre wird er so schnell nicht vergessen. Als es auf 400 Hektar loderte, bis zu 900 Grad heiß,, nachdem die Temperaturen in den Wochen zuvor noch höher, der Regen noch weniger war als sonst in dieser ohnehin kargen Gegend, einer der trockensten Deutschlands.
Zwei Jahre ist das große Feuer nun her. Seitdem sucht Henke nach dem besten Weg für seinen neu entstehenden Wald. Er steht vor einer Frage, die sich in Zukunft häufiger stellen wird: Was soll mit den Flächen geschehen, über die die Flamme hinweggezogen sind? Experten sagen, die Welt könnte am Beginn des Pyrozäns stehen, dem Zeitalter des Feuers. Es wird häufiger brennen – auch in Deutschland. Aktuell herrscht in einigen Teilen Deutschlands bereits die höchste Waldbrandstufe, im nordrhein-westfälischen Gummersbach brannten vergangene Woche 35 Hektar Wald.
Henkes Wald soll widerstandsfähig werden, sagte er, gerade in Zeiten des Klimawandels. Aber auch Ertrag soll erbringen. Ist Kahlschlag die Lösung? Wie er ihn selbst auf einem kleinen Stück und die privaten Waldbesitzer über die gesamte abgebrannte Fläche vollstreckt haben, aus Angst vor dem Borkenkäfer und um das verbliebene Holz. Oder lieber nichts tun? Oder ein „Mischmasch“ aus beidem, wie er es nennt? Für die Antwort hat er einen Teil seines Forstes in die Hände der Wissenschaft gelegt.
“Alles von ganz allein“
Etwa in die von Jeanette Blumröder von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Und die tut vor allem: Nichts. „Das hier kommt alles von ganz allein“, sagt sie inmitten der fast zwei Meter hohen Pappeln. Dazwischen kleine Weiden, Birken und Kiefern. Am Boden hellgrün leuchtendes Moos, das die umgestürzten schwarzen Stämme überwuchert. Kleinode inmitten von Kiefern, die verkohlt sind bis auf halbe Höhe und aufgereiht wie Zaunpfähle. Ein Alter, eine Höhe, akkurat gesetzt im Abstand. Selbst die Furchen sind noch zu sehen, 60 Jahre nachdem hier für die schnelle Ernte gepflanzt wurde. Ein Forst wie viele andere in der Region, der größte Teil in privater Hand, ein kleiner in kommunaler.
Natürlich, so die Ökologin, Pappeln, Weiden, Birken – das seien keine Arten, die später einen echten Wald formen. Aber Laub brächten die erstmal rein und Boden mit einer echten Humusschicht. Danach könne sich alles Weitere entwickeln, Buchen und Eichen. Ein „vielversprechendes Mikroklima“ habe sich schon jetzt hier gebildet. Die Luft ist bis zu fünf Grad kühler, der Boden feuchter, die Erosion geringer als ohne Bäume.
Der Brand in Treuenbrietzen – einer von unzähligen in den vergangenen beiden Jahren. Allein für 2018 zählte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung für Deutschland mehr als 1700 Waldbrände, mehr als viermal so viele wie im Jahr zuvor. Weltweit waren es laut NASA mehr als 4,4 Millionen. Global gesehen sind die Zahlen zwar nicht außergewöhnlich hoch. Die Jahre 2005 und 2007 waren flächenmäßig viel verheerender. Dennoch: Es brennt intensiver und länger an Orten, an denen das vorher nicht geschah. Zu verstehen, was mit der Natur nach einem Feuer passiert, ist also nicht nur für Treuenbrietzen wichtig. Sondern auch für andere Regionen, an denen es in Zukunft lodern wird.
Neugepflanzte Kiefern – vertrocknet
Zurück auf dem Treuenbrietzener Versuchsfeld, einige hundert Meter weiter. Alles ist kahl, mehr als 300 Hektar, bis zum Horizont. Die Luft ist trocken, der Wind pfeift. Vereinzelt ragen Stümpfe auf, braune Nadeln bedecken den Boden. Keine Spur mehr von Grün, von Moosen, einem anderen Farbtupfer. Allein die frischen Furchen deuten an, hier ist etwas im Gange. Neue Bäume sind im vergangenen Jahr gesetzt worden. Schaut man genauer hin, erkennt man sie, die zehn Zentimeter hohen Pflänzchen, grau und unscheinbar – Kiefern. Vertrocknet. Dazwischen einzelne grüne Stiele. Ebenfalls Kiefern, eingesetzt in diesem Jahr.
Den klassischen Weg nennt man das, was hier geschieht. Der geht so: Der Harvester, eine spezielle Holzernte-Maschinesägt die abgestorbenen Baumreihen ab. Der Boden wird umgewälzt, die Asche untergepflügt. Dann wird rasch aufgeforstet mit Pflanzen, die schnell wachsen und Ertrag bringen. Lange hat das funktioniert, als es noch mehr Regen gab.
“Hart mit anzusehen“, nennt das Blumröder. Wie die Fehler der Vergangenheit wiederholt würden. Wie Unmengen an Arbeit, Geld und Ressourcen hineinflössen, um dann keinen Schritt weiter als die Natur zu sein. Im Gegenteil. Die Bäume, die gepflanzt wurden, hätten offensichtlich deutlich schlechtere Aussichten als die, die von selbst als Samen zwischen den verbrannten Stämmen gelandet waren. .
So einfach ist es nicht, gibt Förster Henke zu verstehen. Natur, Moose, Pilze, Feuchtigkeit, das sei alles schön, sagt er mit Blick auf die Flächen, die sich selbst überlassen sind. Bis dort aber von allein Wald entsteht, der auch finanziellen Nutzen bringe, sprich Holz, dauere es zu lange. Die Kiefersiedele sich bei derart großen Flächen nicht ausreichend selbst an. „Da sitzt mir die Stadt im Nacken.“ 100.000 Euro wolle die an Erlös im Jahr aus dem Wald ziehen. „Wenn wir hier nur einen ökologisch wertvollen Wald wollen, müssen wir auf das Ökonomische verzichten.“ Es sei denn, so Henke, die Gesellschaft würde auch für andere Leistungen zahlen. Dass CO2 gespeichert oder die Artenvielfalt geschützt werde, zum Beispiel.
Anruf bei Johann G. Goldammer in Freiburg, einem der bekanntesten Feuerökologen Deutschlands und einer jener Experten, die das Pyrozän vorhersagen. Seit Jahrzehnten untersucht er von Indonesien bis Polen, wie sich Brände, ob natürlich oder menschengemacht, auf die Natur auswirken. Für die besonders trockenen Wälder Nordostdeutschlands gibt er zu verstehen: Eigentlich bräuchte es sogar mehr Feuer.
Seine Idee: Ein Wald nach dem Vorbild der sibirischen Taiga. Bislang, so Goldammer, verstehe man naturnahen Wald allein als artenreichen Mischwald.. „Der Klimawandel wird uns dafür aber an vielen Stellen keine Gelegenheit lassen.“
„Kontrolliert Brennen“ müsste man eigentlich
Nur eine Gattung besiedle weltweit die extremsten Standorte. „Pinus, die Kiefer, mit ihren 105 Arten und ihren tiefen Pfahlwurzeln.“ Die Taiga mache uns vor, wie sie auf nährstoffarmen Sandböden natürliche stabile Systeme bilde. Und das fast in Reinkultur. Den entscheidenden Unterschied mache nur eines: das Feuer. . Das zieht aller 20 bis 30 Jahre darüber hinweg, entfernt schwache Bäume. Gesunde setzen sich durch, neue kommen nach. Verschiedene Altersklassen entstehen, mit viel Licht dazwischen. Parkähnliche Naturwälder statt Plantagen, und dennoch „wirtschaftlich interessant“, nennt es Goldammer.
„Kontrolliert Brennen“ müsste man eigentlich dafür, sagt er, also gezielt kleine Feuer legen. Weil die Vorbehalte dagegen jedoch zu groß sind – Tiere sterben, CO2 und Feinstaub wird frei, Holz als Bau- und Brennträger zerstört – will er die Flammen imitieren. Mit Schafen und Rotwild etwa. Die würden das leicht brennbare trockene Gras fressen und sorgten dafür, dass weniger Bäume nachkommen. Die bräuchten weniger Wasser, mehr Licht bliebe für die ohnehin stärkeren.
Und die Eberswalder Wissenschaftler, was sagen die dazu? „Aus waldökologischer Sicht überhaupt nicht verstehen“ könne er den Vorschlag, erklärt der leitende Ökologie-Professor, Pierre Ibisch. Er sagt: „Auch wenn man vieles noch nicht weiß – gerade für die Anpassung an den Klimawandel ist das komplett die falsche Richtung.“ Noch immer befinde man sich hier in der Zone der Laubmischwälder, das ändere sich auch nicht kurzfristig und auf keinen Fall hin zu einer Situation wie in Sibirien. „Nach wie vor wachsen in ganz Brandenburg spontan Laubbäume, wenn man die nur lässt oder gar fördert.“ Auch Förster Henke ist sich trotz vieler Unsicherheiten vor allem einer Sache gewiss: Den Kahlschlag, den hat er nur gemacht, um zu zeigen, der funktioniert nicht.