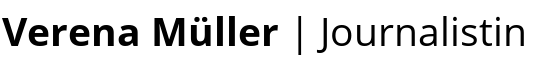Wer ist Vater, wer ist Mutter?
Gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern kämpfen seit Jahren darum, dass beide Partner Eltern sein können. Es steht ein neues Gesetz an.
(u. a. Berliner Morgenpost, Juni 2019)

Kathleen Schreiber und ihre Frau haben es endlich geschafft: Sie haben ein gemeinsames Kind, ein Jahr nach der eigentlichen Geburt ihres Sohnes. Hinter ihnen liegt mehr als ein Jahr, in dem sie Termine beim Jugendamt und Familiengericht durchlaufen, Gehälter und Wohnverhältnisse bis ins Detail offenlegen, einen Prüfbericht bestehen mussten.
Erst dann konnte Schreibers Partnerin den gemeinsamen Sohn offiziell adoptieren und gleichberechtigtes Elternteil werden. Und das, obwohl sich alle bereits vor der Geburt einig darüber waren, wer die Eltern sein sollen – der Spender-Vater, die Mutter und ihre Partnerin.
Geschichten wie die von Kathleen Schreiber und ihrer Familien zeigen: Die gängige Vorstellung von Familiengründung – eine Frau und ein Mann heiraten, sie bekommen ein Kind und werden Eltern – verliert an Allgemeingültigkeit. Die Zahl der Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Paaren groß werden, wächst, von rund 30.000 gehen aktuelle Schätzungen aus. Zudem werden immer mehr Babys geboren, bei deren Entstehung moderne Fortpflanzungsmedizin eine Rolle gespielt hat. Genetische, rechtliche und soziale Elternschaft fallen nicht mehr automatisch zusammen.
Doch die Gesetzeslage hinkt den sozialen und wissenschaftlichen Entwicklungen hinterher. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat dazu ein Papier vorgelegt, wie aus ihrer Sicht das Abstammungsrecht reformiert werden müsste. Recht und Realität sollen so einander nähergebracht werden. Wir erklären, was sie für die verschiedenen Konstellationen vorschlägt.
Bislang gilt für Ehen zwischen Männern und Frauen, dass derjenige Vater ist, der „zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist“ – selbst, wenn das Paar etwa getrennt lebt und das Kind von einem neuen Partner stammt.
Durch diese sogenannte Vaterschaftsvermutung bleibt dem eigentlichen Erzeuger bisher nur der Weg, die Vaterschaft anzufechten. Barley will das nun vereinfachen. Sie schlägt vor, dass sich der biologische Vater bis zu acht Wochen nach der Geburt als Elternteil eintragen lassen kann, sofern sich beide Männer einig sind. Ist das nicht der Fall, bleibt ihm wiederum innerhalb der ersten sechs Monate die Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben.
Prinzipiell festhalten will Barley an dem Grundsatz, dass ein Kind nicht mehr als zwei rechtliche Elternteile haben soll – auch wenn mehrere potenzielle Eltern infrage kommen. Das ist zum Beispiel bei der Embryonenspenden der Fall: Embryonen, die bei einer künstlichen Befruchtung nicht zum Einsatz kamen und üblicherweise zerstört würden, können stattdessen gespendet werden.
Kinder, die sich aus gespendeten Embryonen entwickeln, haben damit vier mögliche Elternteile. Hier regelt Barleys Entwurf, dass die Frau, die das Kind zur Welt bringt, Mutter ist. Der biologische Vater soll zugunsten des Partners der Mutter seinen Anspruch auf Vaterschaft abtreten.
Aus Sicht der Justizministerin ist das Zwei-Eltern-Prinzip das Beste im Sinne des Kindes. Das Argument: Bereits für zwei Eltern ist es häufig schwierig, sich für einen gemeinsamen Weg zu entscheiden. Zusätzliche Personen erschwerten die Situation weiter, insbesondere wenn Trennungen hinzukommen.
Diese sogenannte Vaterschaftsvermutung soll – das ist der Kern von Barleys Entwurf – in Zukunft auch für lesbische Ehepaare gelten. Bislang ist das nicht der Fall, nach aktueller Rechtslage ist die Ehefrau nicht automatisch ein Elternteil für das Kind ihrer Frau. Sie kann bisher nur über eine Stiefkindadoption zur rechtlichen Mutter, zur Mit-Mutter, werden. Dagegen hatte eine Frau geklagt.
Ihre Ehefrau hatte durch eine Samenspende ein Kind bekommen, sie selbst war jedoch nicht automatisch zum Elternteil geworden. Das Gericht hatte die Klage abgelehnt, im Gesetz stehe eindeutig „Vater“, nicht „Mutter“. Zudem könne es im Falle der Vaterschaftsvermutung in heterosexuellen Ehen biologisch möglich sein, dass das Kind vom eigentlichen Ehemann sei.
Barleys Vorschlag sieht vor, den entsprechenden Paragrafen zu ergänzen: „Mit-Mutter eines Kindes ist die Frau, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist.“ Das soll auch für eingetragene Lebenspartnerschaften gelten.
Anders hingegen bei schwulen Ehen. Hier soll auch weiterhin der Partner des Vaters nicht automatisch zum Elternteil werden. Denn die Mutterschaft eines Kindes kann von der Frau, die ein Baby zur Welt bringt, laut Gesetz nicht einfach abgetreten werden. Um mehr als zwei Elternteile zu vermeiden, muss ein Ehepartner in schwulen Ehen deshalb auch in Zukunft den Weg über die Adoption gehen.
Ein Elternteil ist transgeschlechtlich
Frauen, die bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugeordnet wurden, und die ein Kind zeugen, werden nach dem Entwurf aus Barleys Haus auch in Zukunft als „Vater“ des Kindes geführt – auch dann, wenn sie laut Personenstandsrecht Frauen sind. Dasselbe gilt für transgeschlechtliche Männer, die ein Kind geboren haben, sie sollen weiterhin als Mutter des Kindes geführt werden. Das Justizministerium beruft sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2017.
Dahinter steht ein Grundsatz, der auch im Fall von Embryonenspenden greift: Wer ein Kind zur Welt bring, ist Mutter dieses Kindes, unabhängig von genetischen Beziehungen und personenstandsrechtlichen Widersprüchen. In Praxis sieht das dann so aus wie zum Beispiel im Fall von Felicia Ewert: Ewert, die transgeschlechtlich ist, und ihre Frau sind Eltern geworden. Auf der Geburtsurkunde des Kindes ist Ewerts Frau als Mutter eingetragen, weil sie das Kind geboren hat. „Daneben ist mein vorheriger Name in der Kategorie Vater eingetragen“, sagt Ewert.
Dabei habe sie sowohl Namen als auch Geschlecht schon vor zwei Jahren nach dem Personenstandsrecht anpassen lassen. Hintergrund ist das Transsexuellengesetz, in dem festgelegt ist, dass das Rechtsverhältnis zwischen einer transgeschlechtlichen Person und ihren Kindern unberührt bleibt von einer Personenstandsänderung – egal, ob die vor oder nach der Geburt des Kindes erfolgt. „Ich hätte beim Standesamt verschweigen können, dass ich leibliche Mutter bin und hätte mein eigenes Kind adoptieren können“, sagt Ewert. Dann hätte sie auch als Mutter eingetragen werden können. Doch das sei „keine Option“ gewesen für sie und ihre Frau.
Allen Neuerungsvorschlägen zum Trotz: Barley betont, dass die biologische Verwandtschaft auch weiterhin „wesentlicher Anknüpfungspunkt“ für die Zuordnung von Elternschaft sein soll, „da sie ein wichtiges Band zwischen Eltern und Kindern darstellt.“ Biologische Eltern würden sich im Zweifelsfall vorrangig für ihr Kind verantwortlich fühlen, so die SPD-Ministerin. Kerngedanke der Reform ist es, in den Fällen, wo Biologie und Elternschaft nicht deckungsgleich sind, die rechtlichen Verhältnisse leichter anpassen zu können.
Nicht alle sehen dafür Bedarf: Ob eine Anpassung des Familienrechts nötig sei, müsse sorgfältig geprüft werden, sagt Elisabeth Winkelmeier-Becker, rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Der Entwurf der Justizministerin geht ihrer Meinung nach jedenfalls „deutlich zu weit“. Bei der Zuordnung rechtlicher Mutterschaft dürfe nicht auf objektive biologische oder rechtliche Anknüpfungspunkte verzichtet werden.
Die FDP dagegen plädiert für Reformen, die weiter gehen als das, was Barley vorgeschlagen hat: „Barleys Rhetorik verspricht, was ihr Referentenentwurf nicht halten kann“, sagte Jens Brandenburg, Sprecher der FDP-Fraktion für die Anliegen von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen (LSBTI). „Mehr-Eltern-Familien verwehrt die Ministerin eine rechtliche Anerkennung.“