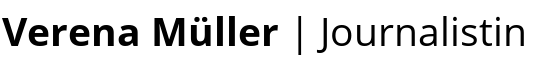Schutz ohne zu schützen
In vielen Naturschutzgebieten Deutschlands geht es den bedrohten Tieren und Pflanzen genauso schlecht wie außerhalb davon. Sind die Gebiete nur ein grüner Anstrich?
(u.a. FUNKE-Tageszeitungen, NATUR, Juli 2020)

Seit vor drei Jahren die Rinder verschwanden, geht es der Natur zusehends schlechter. Hier an den Steilufern der Saale, 20 Kilometer nördlich von Halle. Ohne die Tiere werden die Sträucher nicht mehr klein gehalten, alles wuchert nach und nach zu, seltene Schmetterlinge und Laufkäfer verschwinden langsam. Martin Musche hat mit angesehen, wie es mit dem Stück Land vor ihm, halb Wiese, halb Gestrüpp, zwischendurch vereinzelt ein paar alte Apfel- und Aprikosenbäume, zunehmend bergab geht. „Die Sträucher werden ständig dichter, die Robinien immer größer, irgendwann wird’s Wald. Dann ist die Fläche verloren“, sagt er. Verloren für viele Falter, Insekten und Pflanzen, die viel Sonne und Wärme brauchen.
Musche ist Schmetterlingsforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und beobachtet seit Jahren, wie hier immer weniger Himmelblaue, Silbergrüne und Geißklee-Bläulinge fliegen, drei Tagfalter, die in weiten Teilen Deutschlands gefährdet sind. Und das, obwohl die alte Streuobstwiese seit 20 Jahren unter Naturschutz steht, seit 10 Jahren gar unter dem der Europäischen Union. Sie ist eines von insgesamt fast 27.000 sogenannten Flora-Fauna-Habitaten, kurz FFH-Gebieten. Die hatte die EU in den vergangenen fast 30 Jahren eingerichtet, um bedrohte Tiere, Pflanzen und Lebensräume zu schützen. Wälder, Wiesen, Moore, selbst einzelne Kirchtürme als Winterquartier für Fledermäuse, aber auch viele Äcker, auf denen etwa der Feldhamster vorkommt – knapp zehn Prozent des Landes und fast ein Drittel der Wasserfläche wurden seitdem in Deutschland unter Schutz gestellt.
Das Problem: Was man hier im Osten Sachsen-Anhalts beobachten kann, zeigt sich bundesweit auch an vielen anderen Stellen. Den meisten Schmetterlingen und vielen anderen gefährdeten Tier- und Pflanzenarten geht es in den geschützten Gebieten genauso schlecht wie außerhalb davon. Von dem vermeintlichen Schutz scheinen sie nicht zu profitieren. Musche und seine Kollegen haben 104 Tagfalterarten untersucht und festgestellt, nur ein Viertel kommt auf den eigentlich geschützten Flächen häufiger vor. Der Rest verharrt auch in den Schutzzonen auf seinem Niveau, oft einem sehr niedrigen. Fast die Hälfte der etwa 190 heimischen Tagfalterarten gelten als gefährdet. Laut einem Bericht der Bundesregierung zur Lage der Natur sind hierzulande aktuell knapp zwei Drittel der Tiere und Pflanzen und fast 70 Prozent der Lebensräume, die durch die europäische FFH-Richtlinie, geschützt sind, in einem „unzureichenden“ oder „schlechten Zustand“.
Sind die Schutzgebiete also sinnlos? Und was, im Umkehrschluss, hilft dann, bedrohte Tiere, Pflanzen und Lebensräume zu retten?
„Wirksam sind die Schutzgebiete tatsächlich oft nicht, vor allem nicht für Schmetterlinge und andere Insekten“, sagt Musche. „Viele werden einfach mangelhaft behandelt.“ Soll heißen: Sie werden entweder zuviel bewirtschaftet – zuviel gedüngt, zu häufig gemäht, zuviel Stickstoff aus umliegenden Feldern wird hineingespült. Oder zu wenig. Wie hier, im Falle der alten Streuobstwiese an der Saale. Die Tiere müssten hier weiden, einmal im Jahr müsste sie gemäht werden. Passiert das nicht, verflechten sich die Gräser, ein undurchdringlicher Filz entsteht. Vorher offene Stellen am Boden, die viele Falter brauchen, um sich aufzuwärmen oder auf Weibchen zu warten, verschwinden. Die Pflanzen werden größer und sorgen so für mehr Schatten und Kälte. Wärmeliebende Gewächse verschwinden – und damit die Falter, die von ihnen abhängen.
Besonders hart trifft es die Spezialisten unter ihnen. Einen wie den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, ein kleiner, eher unscheinbarer Schmetterling, mit braunen Flügeln. Zwei Dinge sind in seinem Leben unentbehrlich: Ein Gewächs, der Große Wiesenknopf, und eine Ameise, die Rote Gartenameise. Nur in die Blüten dieser Pflanze platziert er seine Eier, aus denen sich dann die Raupen entwickeln. Sind die groß genug, lassen sie sich zu Boden fallen und verströmen einen süßlichen Honigduft, unwiderstehlich ausschließlich für die Gartenameise. Die schleppt die Raupen als scheinbar sprudelnde Honigquelle in ihren Bau. Dort fressen sich die Raupen solange satt bis sie sich verpuppen – und schließlich zum Schmetterling werden. Wo Pflanze oder Ameise fehlen, fehlt auch der Bläuling.
Zwar haben die EU-Schutzgebiete hierzulande einige Erfolge aufzuweisen – Seeadler, Kranich, Wildkatze und Biber geht es dank ihnen deutlich besser; Millionen Zugvögel wären ohne die Obhut auf ihren Routen in den Süden zum Abschuss freigegeben, deutlich mehr Moore und Feuchtgebiete trockengelegt worden. Ohne Schutzgebiete wäre die Situation vieler Arten ungleich dramatischer, wird später auch Vera Luthardt von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde sagen. Dennoch: In der Gesamtschau geht Deutschland so nachlässig mit seinen sensiblen Zonen um, dass sich sogar die EU-Kommission eingeschaltet hat.
Bereits vor fünf Jahren läutete sie ein Verfahren wegen Vertragsverletzung ein, Anfang des Jahres erhöhte sie den Druck noch einmal. Für die deutschen Schutzgebiete fehlten ausreichend detaillierte und messbare Ziele, der Zustand der Flächen leide, so ihre Kritik. Und auch die Öffentlichkeit werde vielerorts nicht ausreichend darüber informiert, was in den geschützten Gebieten erlaubt ist, was nicht. Ändert sich an diesem Zustand nichts, drohen dem Bund hohe Strafen. Ähnlich hohe wie sie beim Verstoß gegen die zugelassenen Höchstmengen an Dünger und Nitrat im Raum standen. Damals war es um 860.000 Euro gegangen, am Tag.
„Reine Paper Parks“ seien viele der deutschen Schutzgebiete, gibt auch Magnus Wessel von der Naturschutzorganisation BUND zu verstehen. Gemeint sind damit Zonen, die zwar auf dem Papier unter besonderer Obhut stehen, in der Realität aber kaum einen Effekt haben. Auf bis zu zwei Drittel der FFH-Gebiete könne das hierzulande zutreffen, schätzt er. Warum nicht mehr getan werde? Weil das Personal fehle, um Regeln umsetzen und für Konsequenzen zu sorgen, wo etwa Wiesen unerlaubt in Äcker umgewandelt werden. Oder weil es am Willen mangele, etwas zu ändern.
Deutlich wird das für Wessel an den offiziellen Vorgaben für FFH-Flächen. Für den „guten Erhaltungszustand“ muss demnach gesorgt werden, es gilt das „Verschlechterungsverbot“. Für Ackerflächen bedeutet das nach Angaben vieler der zuständigen Landesministerien: Die „gute landwirtschaftliche Praxis“ reicht meist aus. Sprich, das, was generell bislang auf dem Feld erlaubt ist, also auch der Einsatz von chemischen Pestiziden und Düngern. „Was ‚gut‘ ist, ist da natürlich relativ“, sagt Wessel. Selbst der Bericht zur Lage der Natur hatte festgestellt, die eingesetzten Substanzen sind wesentlich für den Artenschwund verantwortlich. Mehr für die FFH-Gebiete selbst zu tun und etwa die Chemikalien darin verbieten, sei zwar laut Wessel „besser als nichts“. Um bedrohte Arten aber wirklich zu erhalten, reiche das nicht aus. Er fordert daher, einen Schritt weiter zu gehen: „Wir dürfen nicht mehr zwischen Schutz- und Schmutzgebieten trennen.“
Die „Landschaft als Ganzes sehen“ und „Integrativen Naturschutz“, nennt das Ökologie-Professorin Luthardt. Demnach dürfe man nicht nur einzelne kleine Flächen im Auge behalten, sondern die gesamte Umgebung, in die sie eingebettet sind. Ein typisches Beispiel, so Luthardt, sei die kleine Feuchtwiese mit seltenen Orchideen. Die werde mit viel Aufwand gehegt und gepflegt, dennoch verschwinde eine Orchidee nach der anderen. Unzählige Ehrenamtliche versuchten, die zu retten, hätten jedoch kaum eine Chance. Denn die Wiese ist eingebettet in eine Umgebung, die entwässert und intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Kurz: Selbst wenn man auf kleinen Inseln bestimmte Methoden verbietet, nützt das wenig, wenn man außerhalb davon weitermacht wie bisher.
Wie das praktisch aussehen kann? „Man muss alle, die in einem Gebiet wirtschaften, an einen Tisch holen, Eigentümer und Nutzer“, sagt Luthardt. Viele Landwirte wüssten ja, dass das, was der Natur auf den Flächen nützt, langfristig auch der Bewirtschaftung dient. Kümmerten die sich um das Wasser, den Boden und die Insektenvielfalt, habe das für alle einen positiven Effekt. Weigerten sich einzelne Eigentümer, sich an den Maßnahmen zu beteiligen, so die Expertin, müsse man notfalls zu staatlichen Regularien greifen. Beim Autobahnbau funktioniere das ja auch. Will da einer nicht verkaufen, wird enteignet. Erst kürzlich hatte eine Anfrage an das Bundesverkehrsministerium erbracht, dass seit 2009 bundesweit mehr als 1600 Enteignungsverfahren für den Bau von Fernstraßen durchgeführt wurden. „Warum sollte das beim Wasser, unserem Lebenselixier, nicht möglich sein?“, fragt Luthardt.
Vorbild für solche „Landschaftseinheiten“ sind aus ihrer Sicht die Biosphärenreservate wie es sie an 16 Stellen in Deutschland gibt. Im Unterschied etwa zum Nationalpark, der vom Menschen möglichst ungestört bleiben soll, ist darin prinzipiell alles zulässig, was auch außerhalb davon erlaubt ist. Die Kommunen und Landnutzer verschreiben sich jedoch gemeinsam dem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und richten ihr Wirtschaften danach aus. „Das zieht viele an, die so eine Lebensart erproben wollen mit Start-ups, Initiativen, Vereinen, alternativen Lebensmodellen“, erklärt Luthardt. Mehr Öko-Landwirte als anderswo gebe es etwa. Eine Verwaltung behält das Reservat als Ganzes im Blick und entwickelt Ideen zur Weiterentwicklung. Die Reservate sind damit eine Art Modellgebiet, in denen ausprobiert werden soll, wie das Gelingen kann, das Zusammenleben von Mensch und Natur Und anders als im FFH-Gebiet oder kleinen Naturschutzgebiet (NSG) schaut man dabei nicht nur auf die einzelne Wiese, sondern auf ganze Gebiete: die ganze Rhön, den ganzen Spreewald, die ganze Mittelelbe-Region. „Da sind dann auch verschmutzte Flächen mit drin, nicht nur die, die von vornherein als schützenswert gelten.“ Eigentlich, so Luthardts Vision, müsste sich jede Gemeinde, jedes Bundesland als Biosphärenreservat verstehen.
300 Kilometer nordöstlich des Saaleufers, kurz vor der polnischen Grenze, Gemeinde Lunow-Stolzenhagen, am Rand des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin liegt der Hof der Hradezkys. Hier weiß man, wie das geht, nützen und schützen zugleich. Und welche Rolle dabei auch hier den Rindern zukommt. 150 davon haben sie in ihrem Betrieb „Stolze Kuh“, mitten im Nationalpark Unteres Odertal. Auf den Wiesen grasen Allgäuer Braunvieh, Tiroler Grauvieh, Schwarzbunte Niederungsrinder und Angler Rotvieh. und halten sie so frei für die Schwarzstörche, See- und Fischadler, die die freien Flächen zum Brüten brauchen. Mit „Milch aus dem Nationalpark“ wirbt die Familie auf ihren Produkten.
Eine andere Chance hätten sie damals gar nicht gehabt als auf die geschützten Flächen zu gehen, erzählt Anja Hradetzky heute rückblickend. Sie wirkt bestimmt, wie eine, die anpacken kann und für ihre Ideale kämpft, wenn man sie erlebt. Als sie und ihr Mann vor fünf Jahren, mit Ende 20, Landwirte werden wollten, waren beinahe alle Ländereien in der weiteren Umgebung vergeben, die Pachten für die wenigen noch freien zu hoch. Allein die Flächen in der Region, die unter Schutz standen, die wollte keiner haben. Nur eine Kuh pro Hektar ist dort erlaubt, man darf keinen Ackerbau betreiben, nicht mähen und nachsäen, keinen Dünger ausbringen. „Da wusste man, das Land liefert weniger Ertrag.“ Entsprechend billig war der Hektar, weniger als die Hälfte kostet der bis heute im Vergleich zu den umliegenden Flächen.
Inzwischen haben sie acht Angestellte, stellen Fleisch, Wurst und Milchprodukte her. Ein „Arbeiten mit der Natur, nicht gegen sie“ nennen sie das. Die Kühe stehen immer auf der Weide statt im Stall, sie fressen Gras statt Silage. Das Futter für den Winter kommt vom eigenen Feld, außerhalb des Nationalparks, statt vom Hersteller aus der Ferne. Die Milch der Kühe wird mit den Kälbern geteilt statt allein für den Verkauf gezapft.
Die Folge: Das Geld ist immer knapp bei ihnen. „Den ganzen Zusatznutzen, den wir für die Natur erbringen, den Schutz der Insekten und Vögel, die CO2-Speicherung in den Wiesen und Mooren, den zahlt uns ja keiner“, sagt die 33-Jährige. Einen Zuschuss für ihre Weide, die sie „extensiv“, also behutsam nutzen, bekommen sie nicht. Das System, das setze vollkommen falsche Anreize, sagt sie und rechnet vor: Da sei ihr Nachbar, der verdiene deutlich mehr. Auch der sei zwar Biobauer, halte aber seine Tiere im Stall. Für die Auen mache der damit nichts. Und dann seien die anderen Betriebe der Umgebung außerhalb des Nationalparks, die konventionellen. Denen ginge es meist auch nicht gut, trotz hoher Subventionen. Denn die flössen fast vollständig in die laufenden Kosten, in Saatgut, Maschinen, Dünger und Pestizide. „Für ihre eigentlichen Produkte, für die bekommen sie ja kaum noch was, so niedrig sind die Preise.“
Zurück auf der alten Streuobstwiese. Dass sich die aktuellen Marktbedingungen ändern, darauf hofft auch Schmetterlingsforscher Musche. Die Wiederkäuer, die waren hier verschwunden, weil sie nicht genügend eingebracht hatten. „Grenzertragsflächen“ werden solche Gebiete genannt. Landwirtschaft wäre zwar möglich, sie lohnt sich nur nicht. Würde der Naturschutz hingegen mehr honoriert, so Musche, könnte es sich auszahlen, hier wieder Galloway-Rinder zu halten. Die könnten den Bläulingen den Lebensraum erhalten. Und die intensive Landwirtschaft an anderer Stelle zurückfahren.