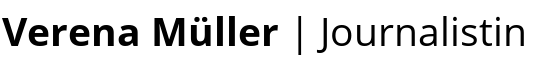Zu schade zum Rauchen
Jahrtausendelang war er ein wertvoller Rohstoff – bis der Hanf illegal wurde. Heute entdecken ihn viele neu: als Öko-Ressource der Zukunft oder Retter für ausgelaugte Tagebaulandschaften. Doch die Vorbehalte sind groß.
(u. a. Sächsische Zeitung, Das Magazin; Nov. 2020)

Eigentlich war er nur auf der Suche nach einer Alternative für seine Felder. Weizen, Gerste und Raps wuchsen immer schlechter auf dem kargen Boden, auf den kaum noch Regen fiel, hier im Osten Sachsen-Anhalts. Auch die kommenden Jahre ließen kaum auf eine Änderung hoffen. Steffen Bergner blinzelt gegen die Sonne an diesem Tag Ende Oktober, im Hintergrund rattert der Mähdrescher und verschlingt eine Pflanzenreihe nach der anderen. „Da bin ich auf Hanf gestoßen.“ Wie wild wachse der hier, drei Meter sind es in diesem Jahr, sagt er in Richtung dessen, was da gerade im Schlund der Maschine verschwindet. „Ohne viel Zutun.“ Kein Unkrautvernichter, kaum Dünger, kaum zusätzliches Wasser.
Einsetzen kann man die Pflanze für fast alles. Als Dämmstoff beim Hausbau, Mittel gegen Entzündungen oder Alternative zur wasserschluckenden Baumwolle. Selbst die Autoindustrie zeigt zunehmend Interesse an ihr, für ihre Innenverkleidungen. Bergner ist eigentlich kein Mann der abwegigen Visionen, keiner der sich zu großen Worten hinreißen lässt. Trotzdem sagt er: „Dem Nutzhanf könnte eine steile Karriere bevorstehen.“
Als eines der „Materialien der Zukunft“ sehen das Kraut auch Ökonomen und Experten für nachwachsende Rohstoffe. Ökologisch, regional, CO2-versenkend, vielseitig verwendbar. Zwar ist die Fläche, auf der die Pflanze in Deutschland wächst, mit rund 4.500 Hektar noch immer klein. Seit 2011 hat sie sich jedoch fast verneunfacht, die Zahl der Anbaubetriebe versechsfacht. Die Pflanze, so die Vision, könnte dort wachsen, wo andere Arten versagen oder deutlich mehr Pflege bedürfen und wo eine neue Branche einen Aufschwung für die gesamte Region bedeuten könnte. Selbst die Bundesregierung geht in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Linken von einem „hohen ökologischen und ökonomischen Potenzial“ aus.
Und dennoch: Das Geschäft mit dem Nutzhanf will in Deutschland nicht recht in Schwung kommen. Geld haben auch Bauer Bergner und einige seiner hanfanbauenden Kollegen bislang kaum mit ihm verdient.
Warum, das ist eine Geschichte von Vorurteilen und Verbrauchern. „Politisch bedingt“ seien die Hürden, wird später Marcel Schmidt neben seinen Hanffeldern im ehemaligen Tagebau sagen.
20 Kilometer von Bergners Hof entfernt sitzt Lutz Klimpel in seinem Büro in der Hochschule Merseburg und erklärt, was es dem Hanf so schwer macht. „Sein Image“, sagt er. Die meisten glaubten, es gehe ums THC. Sprich: ums Kiffen.
THC, kurz für Tetrahydrocannabinol, ist die psychoaktive Substanz, die im Rauschhanf steckt, ihn also zur Droge macht. Im Gegensatz dazu enthält der Nutzhanf kaum THC. Nur den zweiten medizinisch wichtigen Inhaltsstoff, das Cannabidiol CBD, enthält er, je nach Züchtung, in höheren Mengen. Anders als THC macht der aber nicht high, sondern gilt als entzündungshemmend und angstlösend. Das Problem: Von außen lassen sich beide Varianten nicht unterscheiden. Das sorgt für hohe Auflagen und Vorbehalte. Noch immer fällt der Nutzhanf unter das Betäubungsmittelgesetz, auf dem Acker werden Pflanzen zerstört oder geklaut. Selbst die EU-Agrarförderung, die andere Nutzpflanzen erhalten, bekommt er nicht.
Klimpel, Professor für Betriebswirtschaftslehre, hat gemeinsam mit seinen Kollegen die Chancen der Pflanze untersucht und kommt zu der Erkenntnis: Es lohnt sich. Eigentlich. „Vor allem für hochwertige regionale Produkte“, erklärt Mitarbeiterin Ivette Witkowski. Also Öle und Kosmetik aus den Samen, Baustoffe aus den Fasern. Bei Papier und Kleidung sei die Konkurrenz aus China zu groß, ebenso bei Produkten mit CBD. Damit jedoch wirklich „Schwung in die Sache“ komme, sagt Witkowski, müssten sich die Rahmenbedingungen ändern.
Will man in Deutschland Hanf anbauen, muss man sich an strenge Regeln haten. Die Pflanzen dürfen höchstens 0,2 Prozent THC enthalten – im Rauschhanf sind es zwischen 10 und 15 Prozent. Die Fläche muss bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung angemeldet werden, auf der dann nur zugelassene Sorten wachsen dürfen, deren Saatgut man – jedes Jahr aufs Neue – teuer kaufen muss. Etwa das Sechsfache wie für Gerste oder Weizen zahlt man dafür. Auch den Zeitpunkt der Aussaat und den Beginn der Blüte muss man der Bundesanstalt melden. Von dort kommen stichprobenartig Prüfer, die den THC-Gehalt testen. Liegt der zu hoch, kann es passieren, dass die gesamte Ernte vernichtet wird. „Bei Naturprodukten kann der Wert natürlich mal schwanken“, sagt Bauer Bergner. „Ein enormes Risiko.“ Zum Ausfallrisiko kommt noch ein weiteres hinzu: Es mangelt oft an Abnehmern.
Als der Drescher durch ist, greift Bergner nach einem Strohknäuel, das sich an den abgesägten Halmen verfangen hat, eines von unzähligen. Wie Wattebälle wehen sie im Wind, die Fasern, die sich aus den Stängeln gewinnen lassen. „Die würden den Anbau erst lukrativ machen.“ Interessenten dafür hat er trotzdem nicht gefunden. Dabei läuft der nächstgelegene Faserbetrieb, der daraus Baustoffe herstellt, auf Hochtouren. Die hätten aber bereits genügend Lieferanten aus der Region. Was Bergner gefunden hat, sind lediglich eine kleine Ölmühle und eine Bäckerei für einen Teil seiner Samen.
„Der Hanfanbau ist sehr von der weiterverarbeitenden Industrie abhängig“, erklärt auch Klimpels Kollegin Ivette Witkowski von der Merseburger Hochschule. Hanf über weite Strecken zu transportieren, ist nicht wirtschaftlich, sein Volumen zu groß, bevor man die Fasern nutzt. „Die Bauern sind also darauf angewiesen, dass es einen Weiterverarbeiter in ihrer Nähe gibt“, sagt Witkowski. Und da seien wir schlecht bestückt in Deutschland. Bundesweit gibt es aktuell nur vier Unternehmen, die Hanfstroh verarbeiten.
Die Situation scheint vertrackt. Die Industrie wartet darauf, dass mehr Hanf angebaut wird, um ihn etwa für die Automobilbranche und deren Maßstäbe interessanter zu machen. Die Bauern hoffen auf mehr Nachfrage. Auch Subventionen sind ein wesentlicher Grund, warum sich Landwirte für oder gegen eine Pflanze entscheiden. Laut der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe konnte sich der Hanf auch wegen seiner „instabilen Förderung“ bis heute nicht etablieren.
Dabei ist er keineswegs eine Erfindung der Moderne. Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt. Vor mehr als 4.000 Jahren nutzten ihn die Chinesen bereits für Seile, Stoffe und Arzneimittel. Auch in Europa boomte er bis Mitte des 19. Jahrhunderts, bis er durch die Baumwolle in der Textilindustrie abgelöst wurde. 1941 baute Henry Ford gar ein Auto, das zu großen Teilen aus Hanf bestand, aus Kostengründen jedoch nie auf den Markt kam. 1982 wurde der Anbau ganz verboten, seit 1996 ist er unter strengen Auflagen wieder erlaubt.
50 Kilometer südlich von Merseburg lenkt Marcel Schmidt seinen Jeep über eine Sandpiste. Er ist sichtlich stolz auf das, was neben ihm vorbeizieht. Rechts ein Windrad nach dem anderen, dazwischen Felder. Links der Schaufelradbagger, der sich weiter in den Boden frisst. Rechts das Land, wie es einmal aussehen könnte, nachdem man hier im Tagebau Profen ausgestiegen ist aus der Kohle. Links das, was man bis dahin hier betreibt. Schmidt ist Geschäftsführer der Gala Mibrag, einer Tochterfirma des mitteldeutschen Braunkohleunternehmens, die das Land wiederherstellen soll, nachdem man es hier über Jahrzehnte malträtiert hatte. „Mit Hanf hatten wir hier eigentlich nichts zu tun“, sagt er.
Schmidts Aufgabe ist es, den Boden möglichst wieder nah an das heranzubringen, was er vorher war, sodass wieder Weizen, Roggen und Gerste wachsen können. Bis zu acht Meter dick lag hier der Löss. Das Gebiet galt schon immer als ergiebig, achtzig von hundert auf der Fruchtbarkeitsskala. Bis es wieder so weit ist, müssen jedoch mindestens sieben Jahre nach der Stilllegung vergehen. Und zwar so: Loch zuschütten, obendrauf bis zu drei Meter Rohlöss, der Ausgangsstoff. Dann sieben Jahre eine feste Sortenfolge mit dem Ziel: Humus bilden. Jene obersten Zentimeter, die besonders mühsam entstehen, die aber die Pflanzen später besonders gut sprießen lassen. Es folgt eine feste Abfolge aus Waldstaudenroggen und Luzerne, dazwischen eine spezielle Grasmischung. Der Haken: Die Ernte kann, wenn überhaupt, nur als Futtermittel genutzt werden – wirtschaftlich eher uninteressant.
Schmidt stoppt seinen Wagen und steigt aus. Vor ihm halbhohe braune Stängel, an der Spitze kleine Dolden. Dazwischen neue Pflänzchen, die Blättchen zu fünf Fingern geformt. „Jetzt versuchen wir’s hier mit dem Hanf.“ Die „Wuchseigenschaften“ und die potenzielle Verwendung hätten ihn überzeugt. Es ist sein erstes Jahr mit der Pflanze. Wie Bauer Bergner entschied auch er sich für die ölproduzierende Sorte. Die wird zwar hier nicht mal einen Meter hoch, konzentriert sich dafür aber auf die Samen. Die Fasern wäre auch er nicht losgeworden, ist sich Schmidt sicher.
Ein erstes Resümee? Lasse sich bislang schwer ziehen. Zu viel Unerwartetes habe das Jahr gebracht, durch Corona fiel der Abnehmer für die Samen weg. Die Stadtwerke Zeitz hätten jedoch bereits Interesse für einen der nächsten Jahrgänge bekundet, zur Energiegewinnung. Die Erträge, na ja, die seien hier natürlich schlechter als auf echtem Acker. Den Dünger, den lasse er bewusst weg, um den Boden zu schonen. Neben dem Verkauf der Ernte zählt hier aber noch ein zweites Kriterium: Wie sehr verbessert die Pflanze den Untergrund? „Selbst wenn man die Ernte nicht direkt nutzt, ist natürlich die reine Biomasse wertvoll für uns.“ Der Hanf, so hatten bereits andere Versuche gezeigt, soll hier besonders gute Dienste leisten, im Wechsel mit anderen.
Dass Hanf als Rohstoff mehr als nur eine kühne Idee ist, zeigt etwa die Hanffaser Uckermark eG, ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Baumaterialien aus dem Kraut spezialisiert hat. Die Nachfrage sei groß, das Auftragsbuch voll, erzählt ihr Einkäufer Marijn Roersch van der Hoogte. Nicht nur bei den Lebensmitteln wollten die Leute immer mehr Bio, auch im Haus. Der Dämmstoff, der sei ihr meistverkauftes Produkt. Der sorge nicht nur für ein besseres Raumklima und sei weniger anfällig für Schimmel als herkömmliche Materialien. Der sei vor allem nachhaltiger. Styropor oder Glasfaserwolle müssten bereits nach etwa 20 Jahren ausgetauscht werden. „Und dann weiß man nicht wohin damit. Genauso wie mit dem Asbest damals.“ Der Hanf, der halte für mindestens 80 Jahre. Danach komme er einfach auf den Kompost.
Immer wieder fordern Politiker der Linken-Fraktion im Bundestag und verschiedener Landesministerien, die Pflanze aus dem Betäubungsmittelgesetz zu streichen, die bürokratischen Hürden zu senken, Hanf in die EU-Agrarförderung aufzunehmen. Vorbild in Sachen Hanf könnte Frankreich sein, der größte Produzent Europas. Hier wächst mehr als dreimal so viel wie in Deutschland. Der Anbau war nie verboten, die Industrie konnte sich über Jahrzehnte aufbauen, es gelten höhere THC-Grenzwerte, die leichter einzuhalten sind.
Bauer Bergner ist dennoch guter Hoffnung. Selbst unerwünschte Besucher gab es in dieser Saison weniger als in der vergangenen, als das Feld noch an anderer Stelle der Genossenschaftsflächen lag, nahe der Landstraße. Einige Videos seien da im Netz kursiert, die dazu aufriefen „unbedingt mal hinzufahren“ und die Pflanzen „mal rauchen zu müssen“. Auf einigen Hektar wird Bergner auch im kommenden Jahr seinen Hanf anbauen. Um bereit zu sein, wenn die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen plötzlich steigt, wie er sagt. Bis dahin nutzt er den restlichen Teil der Ernte als Futter für seine Tiere – und setzt ansonsten wieder auf die vertrauten Kandidaten, vor allem den Weizen.